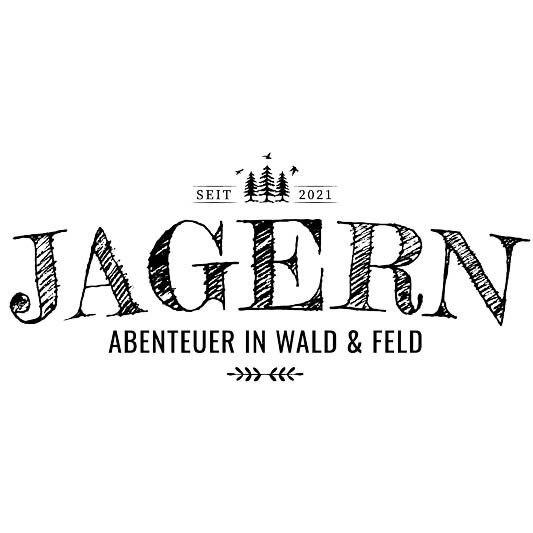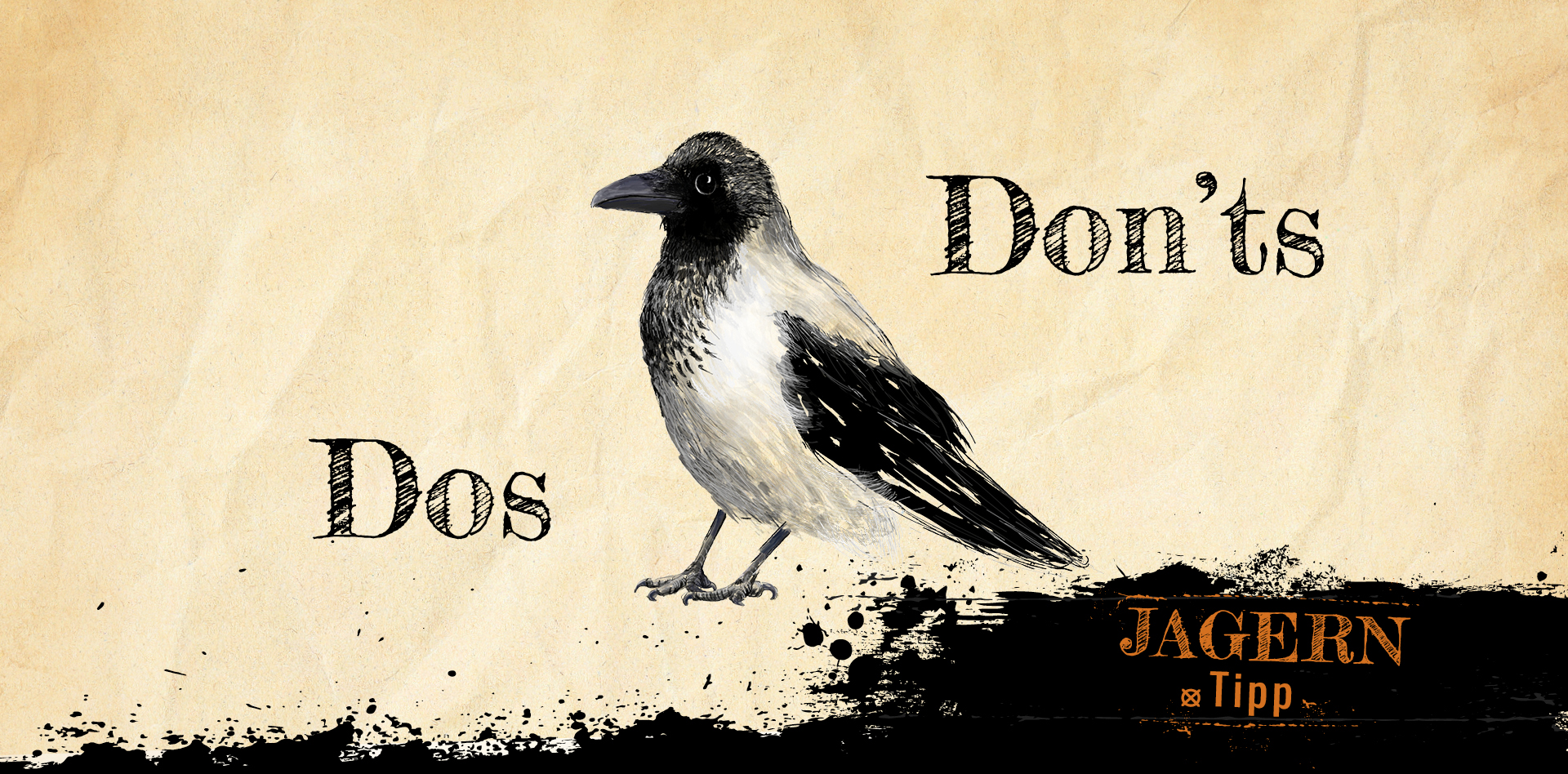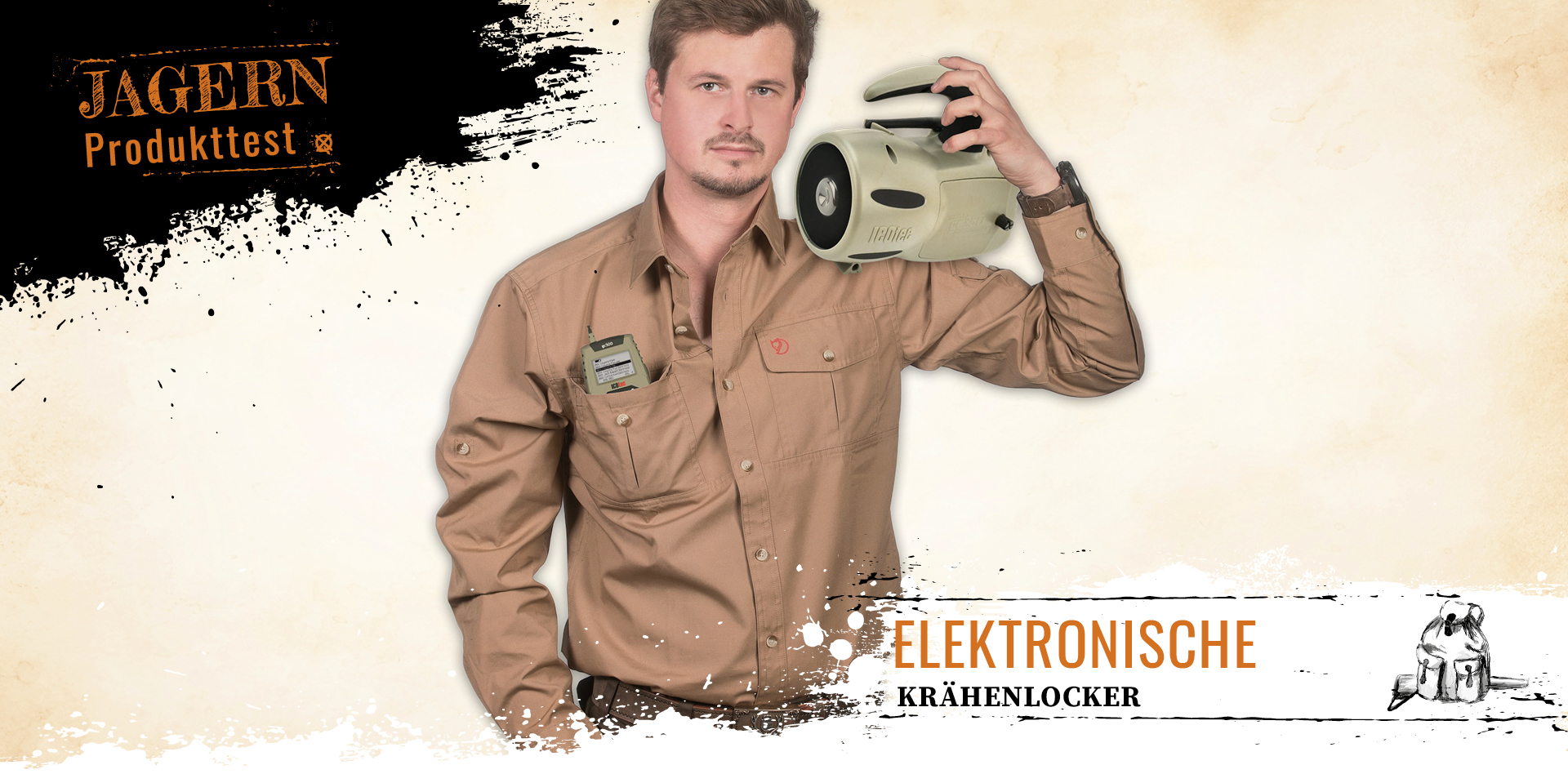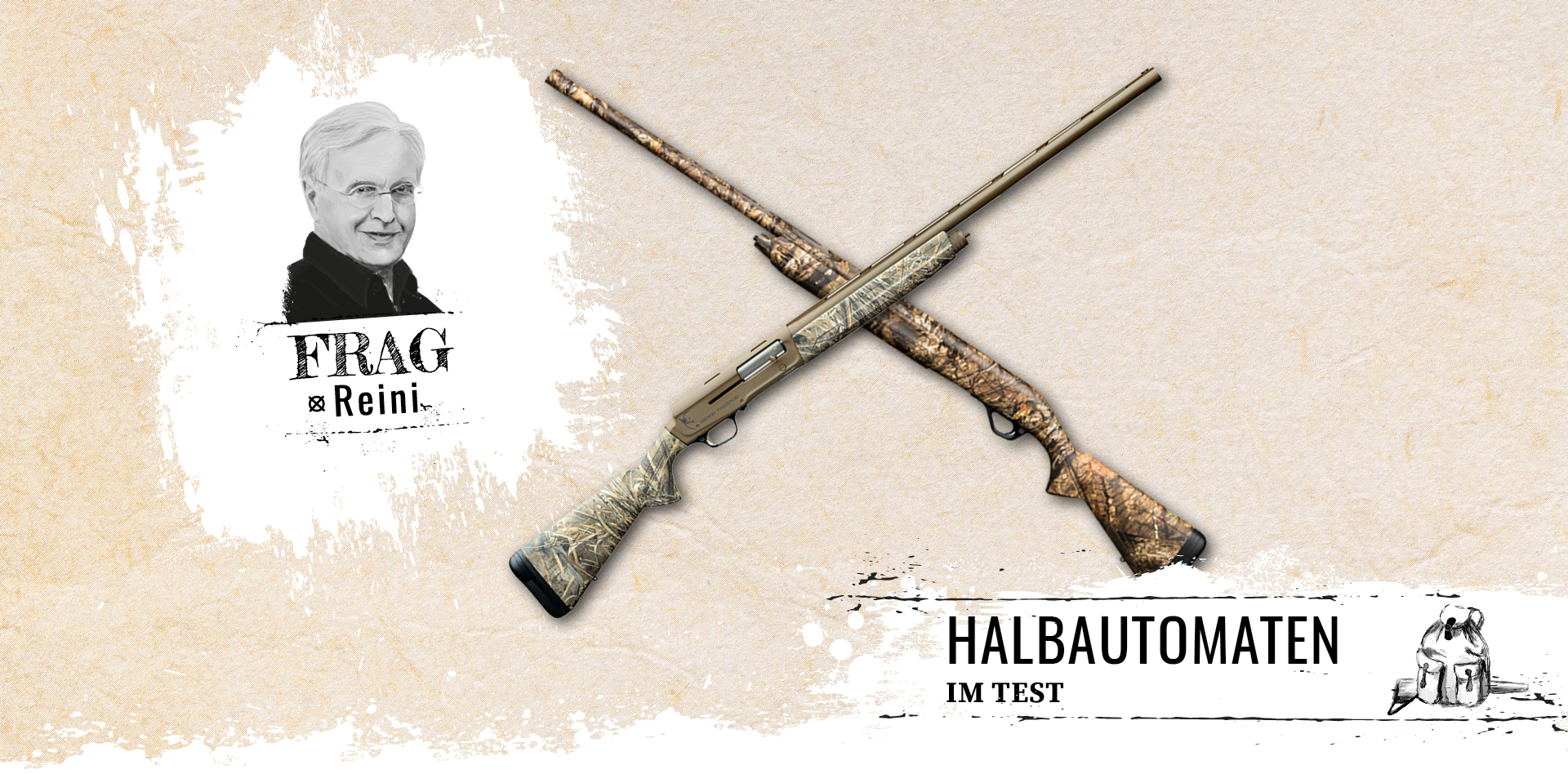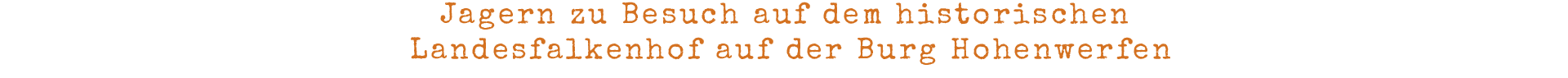
An einem sonnigen Samstag wie diesem hätte sich normalerweise eine Traube Menschen vor dem Eingang zum Lift gedrängt. Und vom malerischen Wanderweg, der sich um den Berg herum auf die Festung schlängelt, wäre ein ebenso fröhliches wie unverständliches Stimmengewirr ins Tal gedrungen. Doch Anfang Mai 2021 liegt die Burg Hohenwerfen auf ihrem spitzen Bergkegel in einer ungewohnten Blase der Beschaulichkeit. Zwei verloren wirkende Autos stehen auf dem ansonsten überquellenden Parkplatz, das Lifthäuschen liegt verwaist im Dunklen. Einzig die Autobahn bietet eine beständige, moderne Geräuschkulisse.
„Wir sind ein internationales Team“, klärt uns der hörbar bundesdeutsche Falkner Felix Hübner auf, als wir uns über das belgische Kennzeichen des Autos wundern, mit dem er uns abholt. Es gehöre seiner Kollegin Keavy Loyson, die schon mit ihrer Tiroler Kollegin Martina Gräßle im historischen Landesfalkenhof auf uns warte, erzählt uns Felix beim Einladen des Equipments.
Kaum sind wir eingestiegen, wird es auch schon spannend, denn wer den Wanderweg auf die Burg kennt, kann sich nur schwer vorstellen, ihn mit dem Auto zu befahren. Wir stellen fest: für Anfänger und Leute ohne Augenmaß ist das auch nichts. Jahrelange Übung aber – Felix ist bereits im vierten Jahr auf der Burg – macht den Meister und so stehen wir innerhalb weniger Minuten im Vorhof auf einem der zwei Parkplätze des Landesfalkenhofs.
Zu Fuß geht es dann die letzten Meter hinauf zum zweiten Burgtor. Hinter diesem öffnet sich die weite Lindenwiese, auf der im Regelfall tausende Menschen gebannt den Flugkünsten der Greifvögel folgen. Heute haben wir sie ganz für uns. Durch eine unscheinbare Holztüre am oberen Ende des Flugplatzes gelangen wir zum Landesfalkenhof, der auch als Wohnhaus der Falkner dient. Dort werden wir schon von den Falknerinnen Martina Gräßle und Keavy Loyson, einem Dutzend Greifvögel, einem Hund, einer Katze und einer großen Kanne Kaffee erwartet.
Eines der Alleinstellungsmerkmale des historischen Landesfalkenhofs sei sicherlich die Verbindung mit der Geschichte, erklärt uns Martina: „Hier hatten die Salzburger Erzbischöfe ihre Falkner stationiert und sind von der Burg aus zur Beizjagd ausgeschwärmt.“ Die Errichtung der ersten Burg vor knapp 1000 Jahre auf diesem scheinbar ins Tal gefallenen Gipfel verwundert nicht, bedenkt man seine Lage von der aus man die Alpentransversale, die Salzburg mit Italien verband, überwachen – und wichtiger noch: besteuern konnte. Die umliegenden Berge und die im Süden weiter werdende Tallandschaft versprachen zudem hervorragende Jagdgründe und einen außergewöhnlichen Ort zum Feiern. Die Geschichte Hohenwerfens und die des UNESCO-Weltkulturerbes Falknerei ist untrennbar verknüpft und auch der Grund, warum der historische Landesfalkenhof vor mittlerweile 27 Jahren hier gegründet und von Josef Hiebeler aufgebaut wurde. Eine Berufsausbildung im herkömmlichen Sinne haben die drei angestellten Falkner Keavy, Martina und Felix aber nicht absolviert, klärt uns Martina auf, die eigentlich AHS-Lehrerin für bildnerische Erziehung und textiles Werken ist: „In Österreich ist ein Falkner jemand, der den Jagdschein und die Falknerprüfung gemacht hat und schlussendlich auch mit den Greifvögeln auf die Jagd geht. Um Falkner zu werden ist es wichtig einen Lehrprinzen zu haben, der einem alles beibringt. Die Falknerei an sich ist leider kein anerkannter Beruf.“
Bereits jetzt wird uns klar, alle drei sind Idealisten. Sie leben für ihre Arbeit mit den 27 Vögeln auf der Burg. Diese zu versorgen und zu trainieren ist eine vielfältige und abwechslungsreiche Aufgabe. Über den Alltag eines Falkners erzählt uns Felix: „Nach dem Frühstück beginnt das Saubermachen und Wiegen. Die Vögel sind mit ihren Volieren ja überall auf der Burg verteilt. Wir müssen sie einzeln holen und täglich abwiegen, denn das Gewicht gibt uns Auskunft, ob der Vogel gesund ist und wie man ihn fliegen kann. Ist er viel zu fett, fehlt ihm die Motivation. Dann setzt er sich aufs Dach und denkt sich, ‚ne, warum muss ich fliegen?‘. Neben dem Training der Jungvögel und dem Füttern nimmt auch das Volierenputzen und die Gartenarbeit viel Zeit in Anspruch. Zwischen den Flugvorführungen machen wir auch Falknereigeräte. Kein Tag ist wie der andere.“
In den normalerweise zwei- bis dreimal am Tag stattfindenden Flugvorführungen kommen Vögel von klein bis groß zum Einsatz. „Wir wollen eine größtmögliche Vielfalt zeigen“, so Martina. „Wir haben verschiedenste Falken, Bussarde, Adler und Geier. Sie unterscheiden sich alle in ihrer Flugweise. Ein Falke etwa ist ein rasanter Flieger, der Bussard zieht eher gemächlich seine Kreise.“
Auch das Training für die Vögel unterscheidet sich von Art zu Art. „Falken sind überwiegend Flugwildjäger“, erklärt uns Felix, „sie trainieren wir auf das Federspiel. Das ist eine Beuteattrappe, die wir schwingen. Der Falke jagt sie dann spielerisch an. Adler hingegen werden gänzlich anders trainiert. Wir arbeiten mit ihnen auf den Faustapell hin. Also dass der Vogel auf die Faust des Falkners zurückkehrt, von der er auch gestartet ist.“
Die für die Krähenbeize geeigneten Vögel haben einen unterschiedlichen Jagdstil und können auch verschieden geflogen werden „Man kann den Wanderfalken etwa als Faustfalke oder als Anwarterfalke fliegen“, meint Felix und führt weiter aus, „bei Ersterem fliegt er direkt von der Faust auf die Beute los, bei Zweiterem kreist er über dem Falkner – oft in hundert Meter Höhe und stürzt sich dann auf die Krähen herab“.
Auch mit Saker- und Luggarfalken könne man auf Krähen jagen, weiß Keavy zu berichten und auch mit Lannerfalken wurde früher auf Krähen gejagt, ergänzt Martina: „Aber immer nur mit einem Pärchen. Allein sind die ziemlich feige.“
Der Ort, an dem auf Krähen gejagt werden soll, ist auch entscheidend für den Einsatz des richtigen Beizvogels. „Der Wanderfalke kommt im Idealfall in einem weiten offenen Gebiet zum Einsatz, Habicht und Wüstenbussard sind wiederum Kurzstreckenjäger“, so Martina, die auf eine weitere Besonderheit des Landesfalkenhofs hinweist: „Die Vögel können bei uns ihren natürlichen Flugstil zeigen. Sie können wirklich fliegen, kreisen und steigen. Sie müssen bei uns nicht von einem Punkt zum anderen fliegen, sondern können sich entfalten.“
„Die Kaiseradler etwa fliegen gerne über dem Tennengebirge“, berichtet auch Felix, „dort nutzen sie ihre Jagdtechnik, machen Sturzflüge und kommen wieder zu uns zurück.“ Dass das so mancher Vogel auch einmal für ein wenig Freizeit ausnützt, davon erzählt er mit einem Schmunzeln: „Es passiert fast wöchentlich, dass ein Vogel mal ein, zwei Tage draußen bleibt.“
Sorgen müssen sich die Falkner aber nur selten machen, denn „die Vögel sind hier zuhause“, weiß Keavy. „Unser Kaiseradler etwa ist schon 22 Jahre alt und sie würde niemals ihre Umgebung hier verlassen.“
„Grundsätzlich ist es aber so, dass Greifvögel nicht domestizierte Wildtiere sind“, gibt Martina zu bedenken. Was sich auch in der die Ausbildung der Tiere niederschlägt. „Man kann bei einem Greifvogel überhaupt keinen Druck anwenden“, berichtet sie. „Er darf nur positive Erfahrungen mit dem Falkner machen und man muss sich vorsichtig herantasten. Man geht wirklich eine Beziehung mit dem Tier ein, die auch gegenseitig sein muss. Und es sind alle Arten etwas unterschiedlich. Die Adler etwa, sind sehr persönlich, die gehen eine partnerschaftliche Beziehung mit dem Falkner ein.“
KRÄHENJAGD mit Greifvögeln
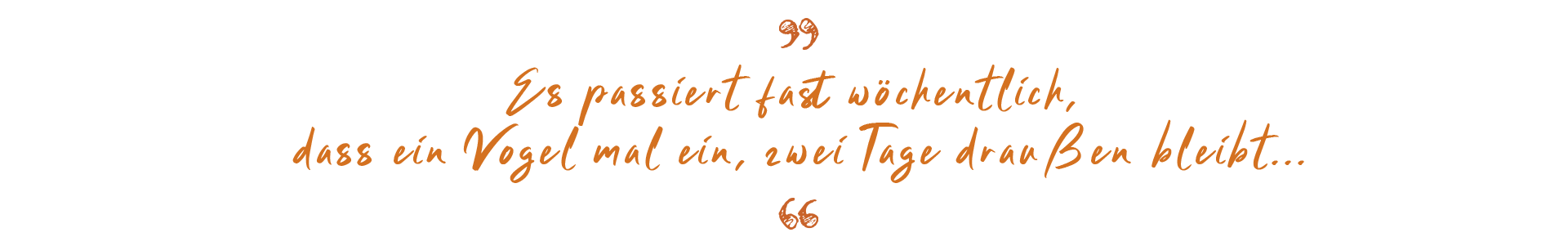
Dass das im Umgang nicht immer ganz einfach ist, davon kann Felix ein Lied singen: „Der Kaiseradler ist mir über ein Jahr nicht auf die Hand gekommen. Erst als ich den Winter allein hier oben war, hat sich mit jedem Vogel eine tiefe Freundschaft entwickelt. Aber es kann auch sein, dass einen ein Vogel überhaupt nicht akzeptiert.“
„Und sie sind sehr nachtragend“, wirft Keavy ein. Warum das wiederum so ist, erklärt uns Felix: „Schon kleinste Fehler können zu Vertrauensbrüchen führen, die nie wieder geheilt werden können. Deswegen muss man bei der Ausbildung von Greifvögeln mit viel Gefühl vorgehen. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Darauf stellen wir uns auch im Team ein. Wenn wir wissen, der Vogel fliegt am liebsten mit diesem Falkner, dann wird auch nur dieser ihn fliegen.“
Dabei sind die Flugvorführungen, für die der Landesfalkenhof weitum bekannt ist, nicht unumstritten. Auf den oft gehörten Vorwurf, sie seien nur Belustigung der Zuseher kontert Martina: „Wir leben in einer Unterhaltungsgesellschaft. Deshalb ist die Flugvorführung auch der richtige Weg, um die Leute auf unsere Greifvögel aufmerksam zu machen!
Leider ist es noch immer so, dass Greifvögel illegal verfolgt werden. Auch bei uns war das bis in die 1950er-Jahre noch mit Abschussprämien unterstützt! Mit den Flugvorführungen können wir die Besucher für diese Tiere sensibilisieren.“
Darin sind sich auch Keavy und Felix einig, welcher noch ergänzt: „Leider gibt es sogar noch gestandene Jäger, die glauben, die Weihen oder der Mäusebussard holen die Hasen auf dem Feld. Man sieht den Mäusebussard natürlich untertags häufig, aber er kann Mäuse fangen und nur mit ganz großem Glück einmal einen jungen Hasen.“ Deshalb sei es wichtig, dass sich auch die Jäger mit den heimischen Greifvögeln auseinandersetzen, denn auch sie sind Teil des Ökosystem eines Reviers. Und er weist auch darauf hin, dass die Flugvorführungen ja nur ein Teil der Arbeit der Falkner sind: „Wir gehen mit den Vögeln auf die Jagd und kümmern uns auch um verletzte oder verwaiste Vögel, die uns gebracht werden.“