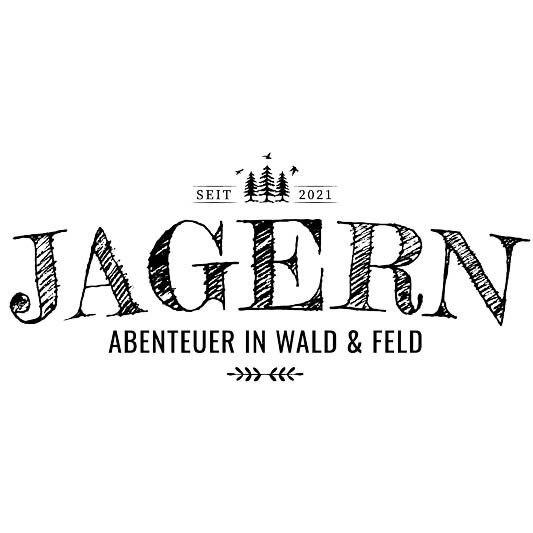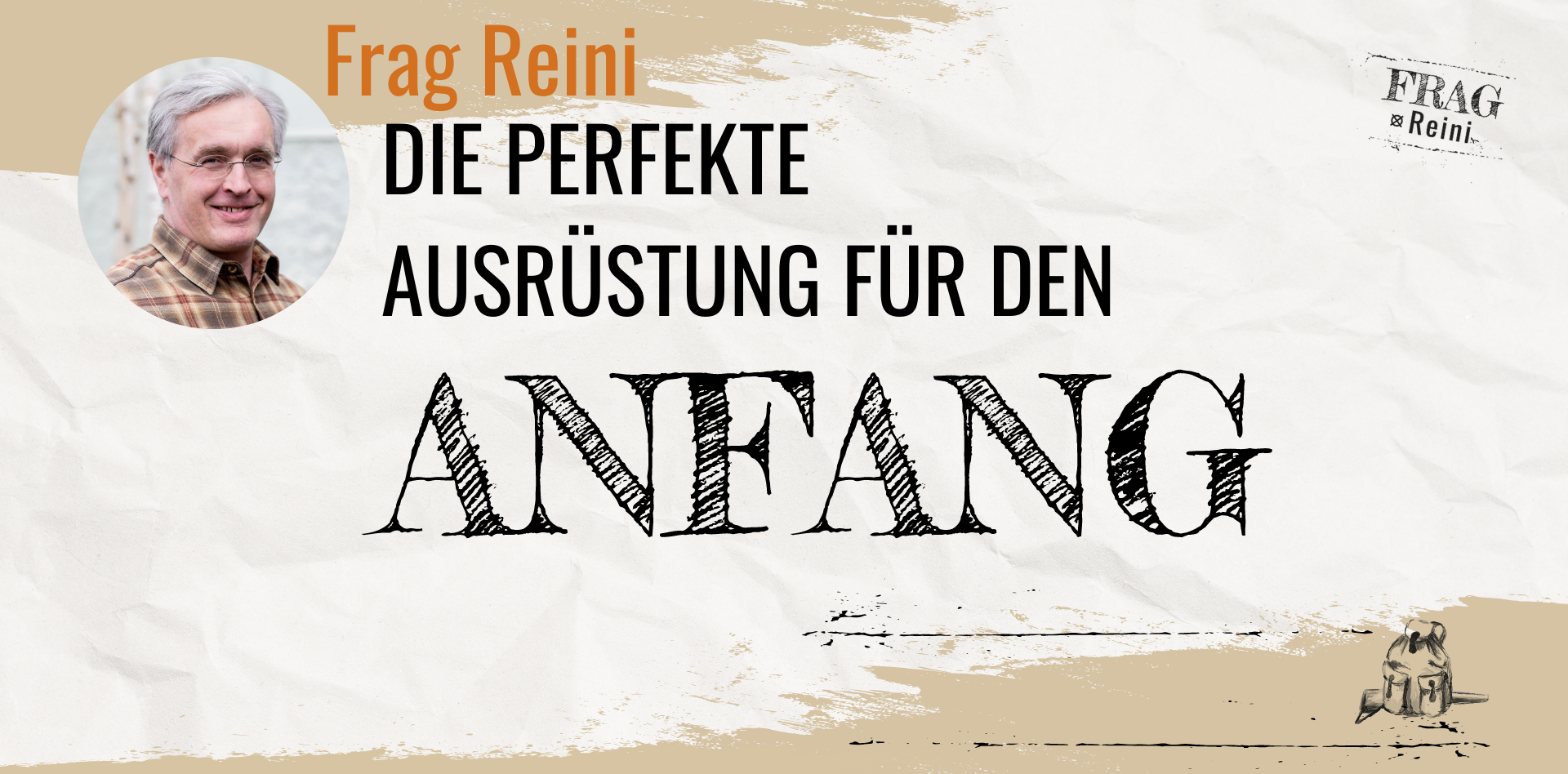Müsste ich die Blattjagd näher beschreiben oder gar quantifizieren, dann so:
Sie steht auf drei Säulen, dem „Wo“, dem „Wann“ und dem „Wie“. Das „Wo“ macht – sagen wir – 50 Prozent des Erfolges aus, das „Wann“ weitere 30 Prozent. Das „Wie“ bestimmt die verbleibenden 20 Prozent.
Aber: Das „Wo“ kann ich nur zu 20 Prozent bestimmen, das „Wann“ vielleicht zu 40 Prozent. Nur das „Wie“, den bei Weitem am wenigsten ausschlaggebenden Teil der Sache, kann ich zu 100 Prozent bestimmen. Und zu der Frage, wie ich blatte, kommt noch der Faktor des „Was“, also der Ausrüstung hinzu. Aber der Reihe nach.
Der rechte Ort
An sich ist dieser ziemlich einfach zu benennen: Der rechte Ort ist da, wo ein suchender Bock ist. Gelegentlich hat man das Glück, einen zu sehen. Dann macht man ein paar Pfiffe, er wird sich recht rasch einstellen und wenn er passt, dann schießt man ihn. Nur: Diese Gelegenheiten sind so selten, dass die Frage nach dem Ort meist ein reines Ratespiel ist. Man weiß zwar übers Jahr hinweg wohl, wo der ein oder andere Bock sich so herumtreibt, aber ob er just in der Blattzeit da ist und ob er da solo des Weges ist? Wenn einer eine verlässliche Antwort auf diese Frage kennt, dann behalte er sie bitte für sich. Damit nähme er mir den Reiz dieser Jagd!
Will ich in der Blattzeit auf einen bestimmten Bock jagen, dann kundschafte ich übers Jahr hinweg sein Revier recht genau aus. Wo tritt er am liebsten aus, zu welcher Zeit, in welcher Witterung? Wo gehen seine Haupt-, wo seine Nebenwechsel? Wo hat er seinen Tageseinstand? All diese Informationen helfen mir in der Blattzeit bei der wichtigsten Frage: Wo ist mein Blattstand?
Hierfür gibt es ein paar Grundregeln:
• Nie vom Dunkeln ins Helle blatten, möglichst vom Hellen ins Dunkle. Treten wir Menschen aus dem abgedunkelten Schlafzimmer ins helle Sonnenlicht, dann sticht das in den Augen und das ist unangenehm. Beim umgekehrten Weg dauert es vielleicht ein wenig, bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat, aber es ist bei Weitem erträglicher.
• Möglichst nicht zu nah an der Dickung blatten, denn sonst wird man vom Bock überrumpelt und steht in der dümmsten aller jagdlichen Situationen, in der nur noch zwei Möglichkeiten bleiben: ansprechen oder schießen. Ein sinnvoller Blattstand gibt genug Zeit, das Wild im Gesamten wahrzunehmen, nicht nur mit dem Auge.
• Trockenes Laub auf dem Boden – sonst der Fluch der Pirsch – ist bei der Blattjagd Gold wert, denn es verrät das anwechselnde Wild. Ein rauschender Bach, der sicherlich sehr zur Romantik der Szenerie beiträgt, ist da weniger hilfreich.
• Das Wichtigste: Ein Blattstand muss ausreichend Schussfeld und Kugelfang bieten. Ich habe gelegentlich direkt im Einstand des Bockes geblattet. Es ist auch gut gegangen, aber eben nur gelegentlich. Darum rate ich dazu nur ungern. Jeder muss selber wissen, ob er sein Wild und dessen Ecken und vor allem seine eigene Reaktionsfähigkeit (oder die seines Jagdgastes) so gut kennt, dass er so etwas wagt.
Denn Blattjagd betreibt man nicht zum Spaß am Anblick. Wenn ich blatte, dann um zu schießen. Es hilft mir nicht, wenn der passende Bock so kommt, dass ich keinen Schuss loswerden kann und er mich wahrnimmt. Diesen Bock bekomme ich in dieser Blattzeit kein zweites Mal her. Das wäre an sich zu verschmerzen. Aber dem Ruf der echten Geiß wird er auch nicht mehr folgen, und dazu gehen wir nicht auf die Jagd. Wenn ich sehe, dass ein unpassender Bock – zu jung, zu gut, warum auch immer – auf den Ruf anwechselt, schweige ich sofort und rühre mich nicht mehr, damit er mich nicht wahrnimmt. Versucht er, mich zu umschlagen und in den Wind zu bekommen, dann hilft ein Ast, ein Stück Holz, ein Stein, den bzw. das ich in gehörigem Abstand zu ihm ins Gebüsch werfe (möglichst dann, wenn der Bock mich nicht sehen kann), und er wird sich verziehen, ohne den Menschen zu begreifen.
Die rechte Zeit
„Nun lieber Jäger, merke gut, und Weidmann, gib wohl acht: Den Bock verwirrt der Sonne Glut, den Hirsch die kalte Nacht.“ Dieses alte Weidgeschrei hat durchaus seine Richtigkeit. Je stechender die Sonne, je schwüler und je heißer die Blatttage, desto erfolgreicher sind sie meistens. Wobei auch das nicht alles ist: Sollte es einmal eine ganze Blattzeit durchregnen, so kommen im nächsten Frühjahr trotzdem Kitze zur Welt. Die Natur ist ziemlich unaufhaltsam. Was mir allerdings die Blatterei ziemlich verderben kann: Vollmond bei Hitze in den hohen Tagen, dann sind die Herrschaften eher des Nachts zu Gange und da darf ich nicht schießen. Und: harte Wetterwechsel von heiß zu kalt. Umgekehrt ist es nicht schlimm: ein verregneter, kalter Juli, und der August kommt dann mit gleißender Sonne – das kann gut werden. Aber drückt es grauenhaft in der Brunft, und bricht dann zu deren Ende hin das Wetter in kalte, graue Regentage, packe ich ein. Getrieben wird zwar trotzdem, aber fauler und vor allem da, wo ich nicht dran kann: im dicksten Dickicht.
Damit sind wir beim zweiten Teil, dem „Wann“. Die Brunft beginnt bei der Geiß ziemlich genau 64 Tage nach dem Setztermin. Es gibt gewisse Schwankungen. Wenn eine Geiß beispielsweise ihre Kitze früh verloren hat, kommt der Eisprung schon eher. Da sich nun die Setztermine in einer Population je nach Kondition der Geiß und nach Witterung über mehrere Wochen streuen, werden die Geißen auch zu unterschiedlichen Zeiten brunftig. Man kann aber recht verlässlich von einer ca. dreiwöchigen „Kernsetzzeit“ ausgehen, entsprechend gilt das dann auch für die Brunft der Geiß.
Der Bock wird nicht von sich aus brunftig, das wird er erst, wenn die Geißen brunftig sind und Pheromone absondern. Aber: Brunftzeit ist nicht gleich Blattzeit! Wenn die Brunft in vollem Gange ist, die Geißen die Böcke an sich binden, dann ist mit dem Blatt wenig gewonnen. Rufen lassen sich die Böcke zu Anfang der Brunft, wenn nur wenige Geißen brunften, vor allem aber zum Ende hin, wenn die meisten Geißen beschlagen sind, die Herren der Schöpfung aber schon noch gerne ein wenig wollen würden. Es lohnt sich durchaus – eigenes Revier vorausgesetzt –, Buch zu führen über die erfolgreichen Blatttage und die Witterung dazu. Als Faust- und Daumenregel lässt sich sagen: Die vorletzte Juliwoche kann gut sein, danach wird es meist schwieriger mit dem Ruf. Um den Monatswechsel herum gibt es gern ganz stille Tage, wo kaum etwas springt. Anschließend nimmt die Sache wieder Fahrt auf, wird gegen Ende der ersten Augustwoche oft richtig furios, um dann zur Monatsmitte hin abzuflauen. Im Flachland liegt alles einige Tage früher als im Gebirge, und eine exakte Wissenschaft ist das auch nicht. In einer Ecke des Reviers kann zur besten Zeit gar nichts gehen, und drei Wälder weiter springen die reifen Böcke einem quietschenden Fahrradreifen hinterher. Zur Tageszeit: Eine jede ist recht. Der Morgen kann gut sein, der Vormittag, die Mittagshitze ebenso wie der Nachmittag oder der Abend, denn: Gebrunftet wird ganztägig.
Die rechte Art
Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, speziell in jagdlichen Dingen auf die zu hören, die wirklich etwas von der Sache verstehen. Und in Sachen Rehruf gibt es eine einzige echte, ausgewiesene Koryphäe: die Rehgeiß. Es lohnt sich, etwa alle zehn Jahre eine Blattzeit ohne jedes Lockinstrument, aber dafür mit offenen Ohren zu verbringen. Ist man oft und lange genug draußen, wird man bald das ganze Repertoire gehört haben: das Fiepen, das Rufen, den Sprenglaut, das große Geschrei, das Angstgeschrei und den Kitzfiep. Was mir dabei immer wieder auffällt: Wir Jäger, die wir stets darauf bedacht sind, verhalten und unauffällig zu Werk zu gehen, blatten auch genauso. Verhalten und unauffällig. Man begebe sich einmal auf eine Tanzveranstaltung und beobachte, welche jungen Damen da die meisten Erfolge feiern: Die verhaltenen und unauffälligen sind es gemeinhin nicht. Die meisten Jäger, die ich beim Blatten begleite, sind sehr erstaunt, wenn sie beispielsweise den Sprengfiep einer echten Geiß hören: Der ist alles andere als zart und leise!
Wie man nun blattet, hängt von der gesamten Situation ab. Hat man überall frische Hexenringe gefunden, ist die Brunft also in vollem Gang, wird man anders blatten als wenn man viele suchende Böcke sieht. Ich kann nur sagen, wie ich es mache, und das ist halt meine Art und nicht das Patentrezept. Ich beginne meistens mit dem sehr leisen Kitzfiep, sozusagen zur „Vorfeldaufklärung“. Ich möchte vermeiden, dass die Geiß hinter mir losschreckt, wenn ich auf den Bock in Anschlag gehe. Dann, nach einer gewissen Pause, gebe ich eine Serie von normalen Fieptönen, nie in nur eine Richtung, ich wende mich im Kreis herum, denn die Geißen, die ich beim Ruf beobachtet habe, die machen es genauso. Die rufen nicht stur nach vorne, sondern bewegen sich dabei. Nach dieser Serie: Stille, und horchen. Schimpfen Vögel irgendwo, speziell Amsel, Meise und Fink? Höre ich Rascheln am Boden? Plätzen, Fegen? Sprich: Regt sich irgendwo in Hörweite ein Bock? Je nachdem, was ich höre, gebe ich die nächsten normallauten Fieptöne – oder ich werde etwas fordernder, lasse den Ton etwas länger stehen und am Ende etwas stärker abfallen. Danach: wieder eine Pause, wieder horchen. Gegebenenfalls gehe ich zum Sprengfiep über, sollte ich hören, dass sich irgendwo einer herumdruckt und nicht heraus mag. Regt sich immer noch nichts, warte ich noch fünf oder zehn Minuten zu und wechsle dann den Stand.
Es gibt manche, die sagen: Immer eine Stunde sitzen bleiben, der alte Bock kommt erst sehr spät. Ganz ehrlich: Ich habe die Geduld dazu nicht, und nach meiner Erfahrung wäre der alte Bock – wenn er denn tatsächlich eine Stunde nach der letzten Strophe gekommen ist – auch ohne jede Blatterei dahergekommen. Also gehe ich weiter. Aber: Ich gehe nicht fünf Stände weiter, noch nicht einmal einen Stand. Da ich die Wechsel und Wege weit, mache ich zehn oder zwanzig leise Schritte, dann fiepe ich drei, vier Mal. Verhoffe, bewege mich ein wenig weiter fort, fiepe wieder. Sprich: Ich versuche, mich wie eine Geiß zu verhalten, die sich im normalen Äsungstempo fortbewegt und dabei gelegentlich ruft. Je näher ich dem bekannten oder vermuteten Einstand des Bockes komme, desto seltener rufe ich, aber umso fordernder! Ich nenne das: „Dem Bock ins Schlafzimmer gehen.“ Irgendwann kommt er, entweder weil er will, oder weil ihn dieses aufdringliche Weibsbild furchtbar nervt.
Das rechte Zeug
Der Blatter: Da der Ton, den man erzeugt, eine gewisse Modulation haben muss, ist es gescheiter, wenn man ein Instrument nutzt, das diese Modulation zulässt – ich rede vom Abfallen des Tons am Ende des Lauts. Das brauche ich beim Fiepen schon, beim Sprengfiep erst recht und beim Geschrei ganz besonders. Alles, was wie ein Klarinetten-, also wie ein einfaches Rohrblattmundstück gebaut ist, hat sich da bewährt. Es gibt viele gute Blatter auf dem Markt, aber bisher – zumindest nach meinem Empfinden – keinen, der wirklich universell einsetzbar wäre. Darum habe ich mit Nils Kradel von der „Lockschmiede“ einen solchen Blatter konzipiert, angelehnt an die Locker, die mein Großvater Herzog Albrecht von Bayern für sein steirisches Gebirgsrevier „Weichselboden“ gebaut hat und die sich größtenteils in meinem Besitz befinden. Er lässt sich von Kitz bis Altgeiß laut wie leise und vor allem freihändig spielen – ein entscheidender Vorteil, wenn der Bock zusteht und dann hinter Hindernissen verhofft. Da habe ich beide Hände schon an der Waffe und muss dennoch weiterrufen können.
Zur Waffe soll Folgendes gesagt sein: Vertraut muss sie sein, das ist das Wichtigste. Ist sie führig, dann ist es umso besser. Liegen muss sie perfekt, man hat selten Zeit für einen überlegten, schulbuchmäßig aufgelegten gezirkelten Schuss, und oft genug geht es über den Stecken oder aus der freien Hand. Im Kaliber würde ich zu dicken und langsamen Kugeln raten. Der Schuss geht selten weit, aber nicht immer ist das Schussfeld komplett frei.
Zur Kleidung: Leise muss sie sein, und sie muss perfekt im Gelände aufgehen. Blattjagd ist Nahkampf. Das wichtigste Utensil für mich bleichhäutigen Menschen sind dunkle, dünne Handschuhe. Meine Hände sind beim Blatten viel in Bewegung, und wären sie nackt, dann würden dauernd zwei weiße Fahnen durch den Wald flattern. Mein Gesicht halte ich durch einen breitkrempigen Hut bedeckt, und den Bart lasse ich mir als natürliche Tarnung schon ab Anfang Juli so hoch als möglich stehen. Ansonsten lasse ich jeden Fleck meiner Haut, die halt nicht bräunen mag, bedeckt. Schwitzen ist besser als blitzen.
Ein Wort noch zum Schuhwerk: Leicht, leise und dünnsohlig soll es sein, denn ich muss mit meinen Fußsohlen den Waldboden lesen können. Bin ich nicht im völlig unwegsamen Steilgelände unterwegs, dann kennt man die Ecken, in denen ich gerade blatte oft genug daran, dass draußen vor dem Wald ein Stiefelpaar steht. Ich will leise, so unahnbar und unentdeckbar sein, wie es irgend geht. Muss ich rascheln oder plätzen, dann kann ich das auch strumpfsockig oder – sogar noch lieber – barfuß. Es ist so schön und erfüllend, man wird noch mehr eins mit dem Wald, wenn man ihn mit der Haut berührt. Und ist das nicht eigentlich die rechte, die echte Jagd? Eins werden mit der Natur, dem Wald, der Weite?
Ich wünsche Ihnen erfüllte Stunden in der für mich höchsten Zeit des Jagdjahres!
TEXT: Bertram Graf Quadt