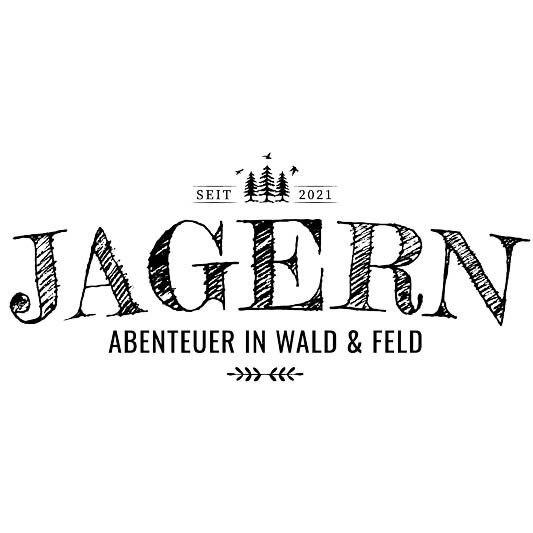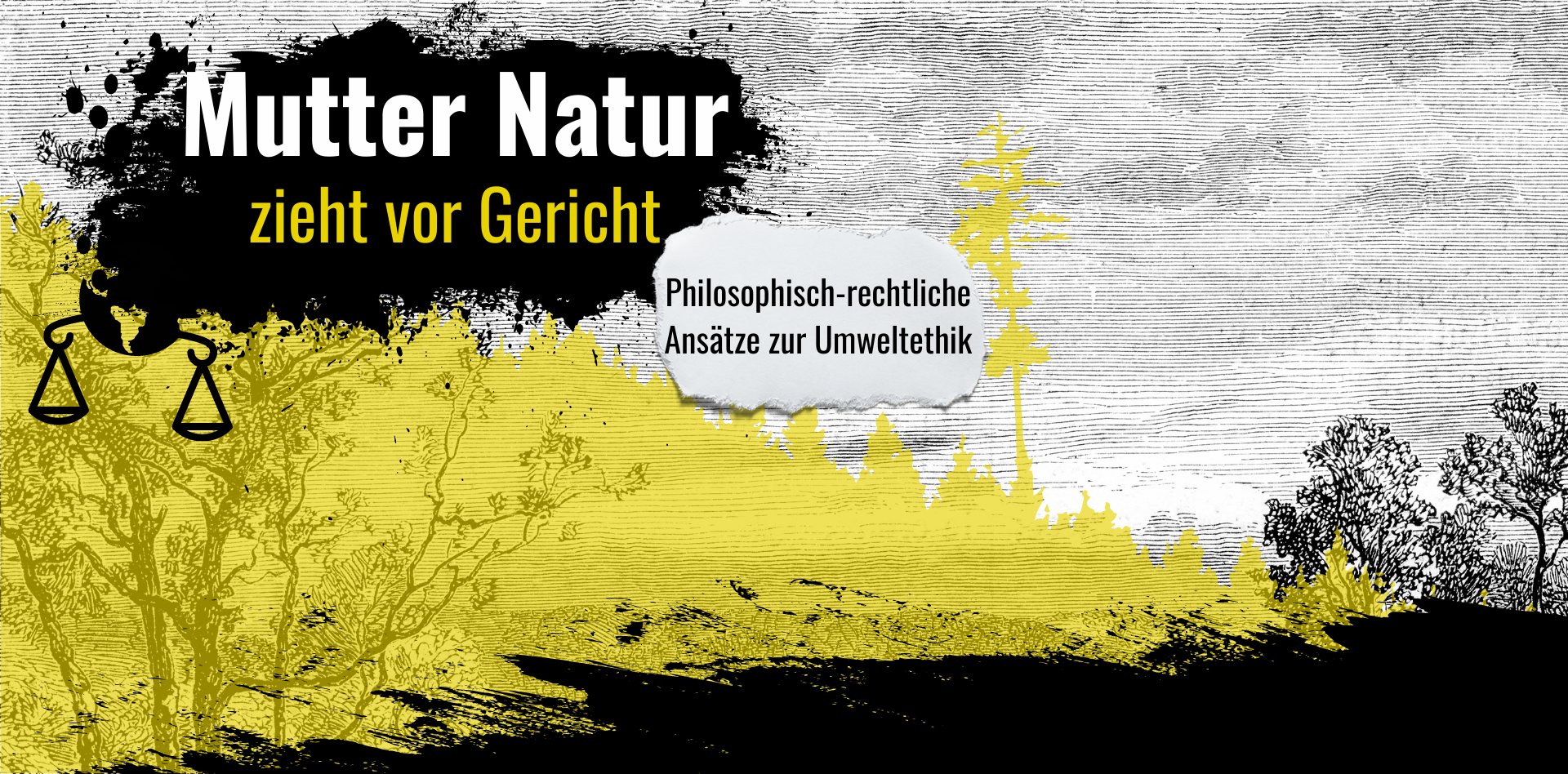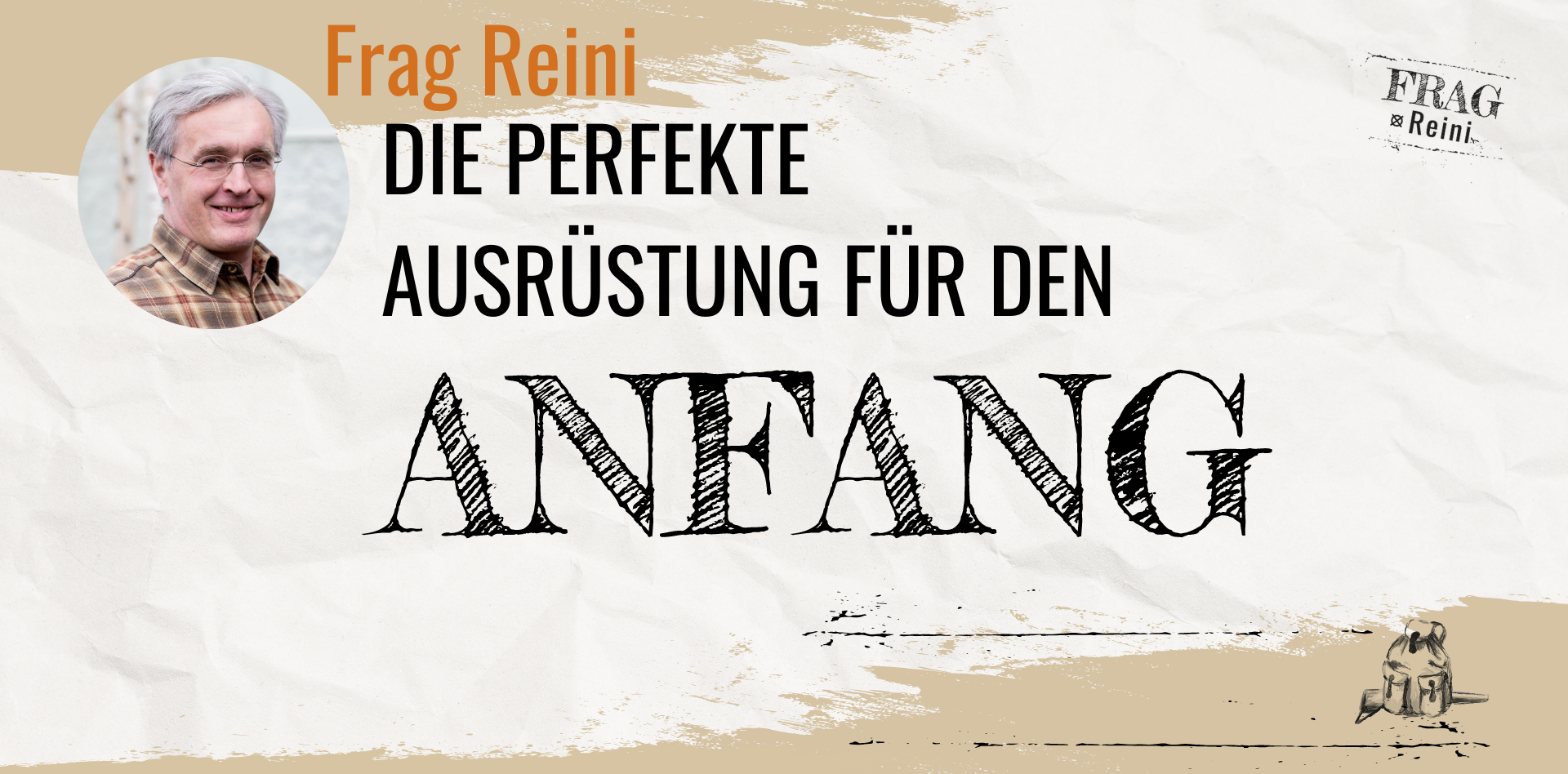Egal, ob als steinzeitliches Jagdrevier oder modernes Tourismusgebiet –
seit Jahrtausenden wird die Natur von der Menschheit in vielfältigster Weise
genutzt. Es verwundert daher wenig, dass die Beziehung zwischen Mensch und
Umwelt nicht selten der Gegenstand von philosophischen Überlegungen war und
immer noch ist. Angesichts der ökologischen Auswirkungen einer globalisierten
Wirtschaft und des voranschreitenden Urbanisierungsprozesses kann ein kurzer
Blick auf die verschiedenen naturbezogenen Denkansätze der abendländischen
Philosophie einem dabei helfen, sich über seine ganz eigene Beziehung zur
Umwelt klarer zu werden. Anhand einiger Beispiele aus lateinamerikanischen
Ländern wird zudem ersichtlich, wie eine Verbindung aus neuen und alten Ideen
unseren heutigen Umgang mit der Natur positiv beeinflussen kann.
Egal, ob als steinzeitliches Jagdrevier oder modernes Tourismusgebiet – seit Jahrtausenden wird die Natur von der Menschheit in vielfältigster Weise genutzt. Es verwundert daher wenig, dass die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt nicht selten der Gegenstand von philosophischen Überlegungen war und immer noch ist. Angesichts der ökologischen Auswirkungen einer globalisierten Wirtschaft und des voranschreitenden Urbanisierungsprozesses kann ein kurzer Blick auf die verschiedenen naturbezogenen Denkansätze der abendländischen Philosophie einem dabei helfen, sich über seine ganz eigene Beziehung zur Umwelt klarer zu werden. Anhand einiger Beispiele aus lateinamerikanischen Ländern wird zudem ersichtlich, wie eine Verbindung aus neuen und alten Ideen unseren heutigen Umgang mit der Natur positiv beeinflussen kann.
Der Anthropozentrismus stellt eine schon relativ alte, aber nichtsdestotrotz noch sehr verbreitete umweltbezogene Perspektive dar. Die Herkunft des Namens erklärt gleichzeitig auch die theoretische Grundannahme jener Denkweise. Die Bezeichnung leitet sich von den beiden altgriechischen Wörtern für „Mensch“ (ánthrōpos) und „Mittelpunkt“ (kéntron) ab. Die Natur ist im Rahmen dieser philosophischen Perspektive nur in jenen Bereichen schützenswert, in denen sie einen ökonomischen oder auch ästhetischen Nutzen für den Menschen hat. In Mittelalter und Früher Neuzeit wurde der anthropozentrische Ansatz mit religiösen Argumenten untermauert. So ist laut gängiger Bibelübersetzung in Genesis 1,28 davon die Rede, dass sich der Mensch die Erde unterwerfen und über sie herrschen soll. Im 17. Jahrhundert machte der durch seinen Grundsatz „Ich denke, also bin ich“ bekannte Philosoph René Descartes den Anthropozentrismus zu einem wesentlichen Bestandteil der von ihm geprägten Denkschule. Die Unterscheidung zwischen Geist und Materie ist grundlegend für diesen sogenannten „Cartesianismus“, wobei nur dem Menschen eine geistige Veranlagung und damit philosophische Bedeutung zugesprochen wird. Der englische Philosoph Francis Bacon sprach sich ungefähr zur selben Zeit für eine möglichst weitgehende Beherrschung der Natur durch den Menschen mithilfe der Wissenschaft aus. Durch den technischen Fortschritt im 19. Jahrhundert rückte dann jenes Ideal von der völligen Kontrolle über die Umwelt in scheinbar greifbare Nähe, was sich durch die Begradigung von Flüssen und die massenhafte Urbarmachung von Sumpflandschaften äußerte. Heutzutage geht eine modernere Auffassung des anthropozentrischen Standpunktes zwar nach wie vor von der Einzigartigkeit der Menschheit aus, betont aber gleichzeitig die damit einhergehende Verantwortung gegenüber der Natur, woraus sich die Pflicht zu deren Schutz ergebe.
Ein grundlegend anderer Ansatz des Naturverständnisses wird anhand der Diskussion über den Umgang mit Tieren deutlich. Der antike Philosoph Pythagoras – den meisten dürfte er noch aus der Schule wegen des nach ihm benannten mathematischen Grundsatzes bekannt sein – war vom Prinzip der Seelenwanderung überzeugt. Aus diesem Grund lehnte er den Verzehr von Tieren ab, da diese die Seele eines verstorbenen Verwandten oder Freundes beinhalten könnten. Jahrhunderte später wies der Engländer Jeremy Bentham darauf hin, dass Tiere genauso wie Menschen Schmerz empfänden und daher auch das Recht auf einen gewissen Schutz besäßen. Dieser Gedanke war entscheidend, da dem Tier als Teil der Natur ein Wert an sich beigemessen wurde. Auf dieser Grundlage aufbauend entwickelte sich viel später das philosophische Modell des Biozentrismus, welcher allem Lebendigen eine gewisse ethische Bedeutung zumisst. Die radikale Position innerhalb jener Denkweise geht sogar von einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit sämtlichen Lebens aus. Auch in seiner gemäßigten Ausformung bildet der Biozentrismus auf jeden Fall den Gegenpol zum Anthropozentrismus.
Die Umweltethik als eigene Disziplin entstand in den 1930er-Jahren und ist im Wesentlichen auf die Arbeiten von Aldo Leopold zurückzuführen. Der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln gilt heute zudem als Begründer des wissenschaftlich fundierten Wildtiermanagements. Leopold entwickelte die Maxime, dass menschliche Eingriffe in die Umwelt nur dann gerechtfertigt seien, wenn sie zur Erhaltung der ökologischen Stabilität und natürlichen Schönheit beitragen. In den 70er- und 80er-Jahren trat wiederum die aus der Technik entspringende Macht des Menschen gegenüber der Natur in den Fokus der Denker, diesmal jedoch im negativen Kontext. Es wurde betont, dass wir es einerseits zwar vermögen, ganze Teilbereiche von Ökosystemen auszulöschen, andererseits aber das so entstandene Ungleichgewicht nur schwer wieder unter Kontrolle bekommen können. Daher wurde eine besondere Pflicht des Menschen betont, den Ansprüchen der Natur Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang sprach Hans Jonas, der berühmte Theoretiker der Verantwortung, davon, dass es sich bei der Biosphäre um ein Treugut der Menschheit handle. Der Physiker und Naturphilosoph Klaus Michael Meyer-Abich verfolgte diesbezüglich einen ganzheitlichen Ansatz und ging von einer Einheit zwischen Mensch und Natur aus.
Quasi den umgekehrten Weg ging man in Südamerika. In Kolumbien etwa hat der lokale Teil des Amazonasgebietes durch einen Entscheid des obersten Gerichts seit April 2018 die juristische Stellung einer Person. Bereits zehn Jahre zuvor wurde in Ecuador Mutter Erde selbst zum Rechtssubjekt erklärt. Im über Jahrhunderte hinweg tradierten Glauben der indigenen Andenvölker wird diese „Pachamama“ genannt und ist in Gestalt einer lebensspendenden Göttin Gegenstand intensiver Verehrung. Seit einiger Zeit ist „Pachamama“ zusätzlich ein Schlüsselbegriff indigener Identitäts- und Sozialpolitik, was sich unter anderem daran ablesen lässt, dass der Rechtsstatus dieses Konzeptes sogar in die ecuadorianische Verfassung aufgenommen wurde. Das Beispiel machte Schule und so existieren mittlerweile auch in Ländern wie Indien, Neuseeland oder den USA ähnliche Gesetze, freilich nicht immer mit religiös-weltanschaulichem Hintergrund. Wenn nun die festgelegten Rechte eines Flusses, einer Region oder überhaupt der ganzen Umwelt verletzt werden, wird die Natur selbstverständlich nicht persönlich beim zuständigen Amt vorstellig werden und eine Klage einreichen – Umweltschutzorganisationen oder besorgte Einzelpersonen aber sehr wohl, da diese in einer Art Stellvertreterposition vor Gericht ziehen können. Auf diese Weise ist es möglich, Belange des Naturschutzes direkt in den ökonomisch-rechtlichen Entscheidungsfindungsprozess einfließen zu lassen. Die Natur beziehungswiese ihre Vertreter stellen aber eben nur einen von mehreren Akteuren in der Diskussion dar und nach wie vor wird häufig wirtschaftlichen Interessen der Vorzug gegeben. Gerade in lateinamerikanischen Staaten ist das nicht selten der Fall, da die dortige Ökonomie stark von der Förderung und dem Export von Rohstoffen abhängig ist. Dieses Problem versuchte man 2007 in Ecuador mittels einer revolutionären Idee zu lösen. Von höchster politischer Stelle wurde vorgeschlagen, dass man von der Förderung großer Mengen an Mineralöl im Naturschutzgebiet Yasuní Abstand nehmen könnte, wenn die globalen Wirtschaftsmächte die Hälfte des Verkaufswerts der dortigen Vorkommen an dem fossilen Energieträger an den ecuadorianischen Staat zahlen würden. Das ehrgeizige Projekt scheiterte jedoch 2013 an ungenügender Finanzierung und Verhandlungsproblemen.
Ein Blick in die Geschichte der Philosophie zeigt, dass sich der Mensch schon seit Jahrtausenden Gedanken über seine Beziehung zur Umwelt macht. Lange Zeit wurde der Natur dabei – mal mehr, mal weniger – nur eine Rolle als passiver Ressourcenspender zuerkannt. Wie einem das südamerikanische Beispiel vor Augen führt, hat sich diese Situation heute jedoch grundlegend geändert.
Die Problematik rund um das menschliche
Eingreifen in die Natur stellt aber angesichts des Klimawandels nichtsdestotrotz
wohl eine der größten Herausforderungen für Gegenwart und Zukunft dar. Durch ihr
standesbedingtes Naheverhältnis zur Natur kommt den Jägerinnen und Jägern in diesem
Kontext eine ganz eigene Rolle zu, welche mit keinem geringen Ausmaß an
Verantwortung einhergeht. Durch das Nachdenken über unsere Position im
Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur können wir dazu beitragen, eine möglichst
eine möglichst ausgewogene Beziehung zwischen den beiden Interessensfeldern herzustellen.
TEXT: Othmar F. Hofer