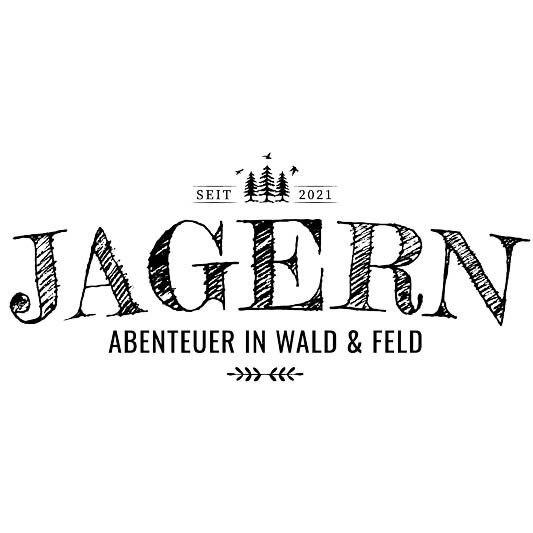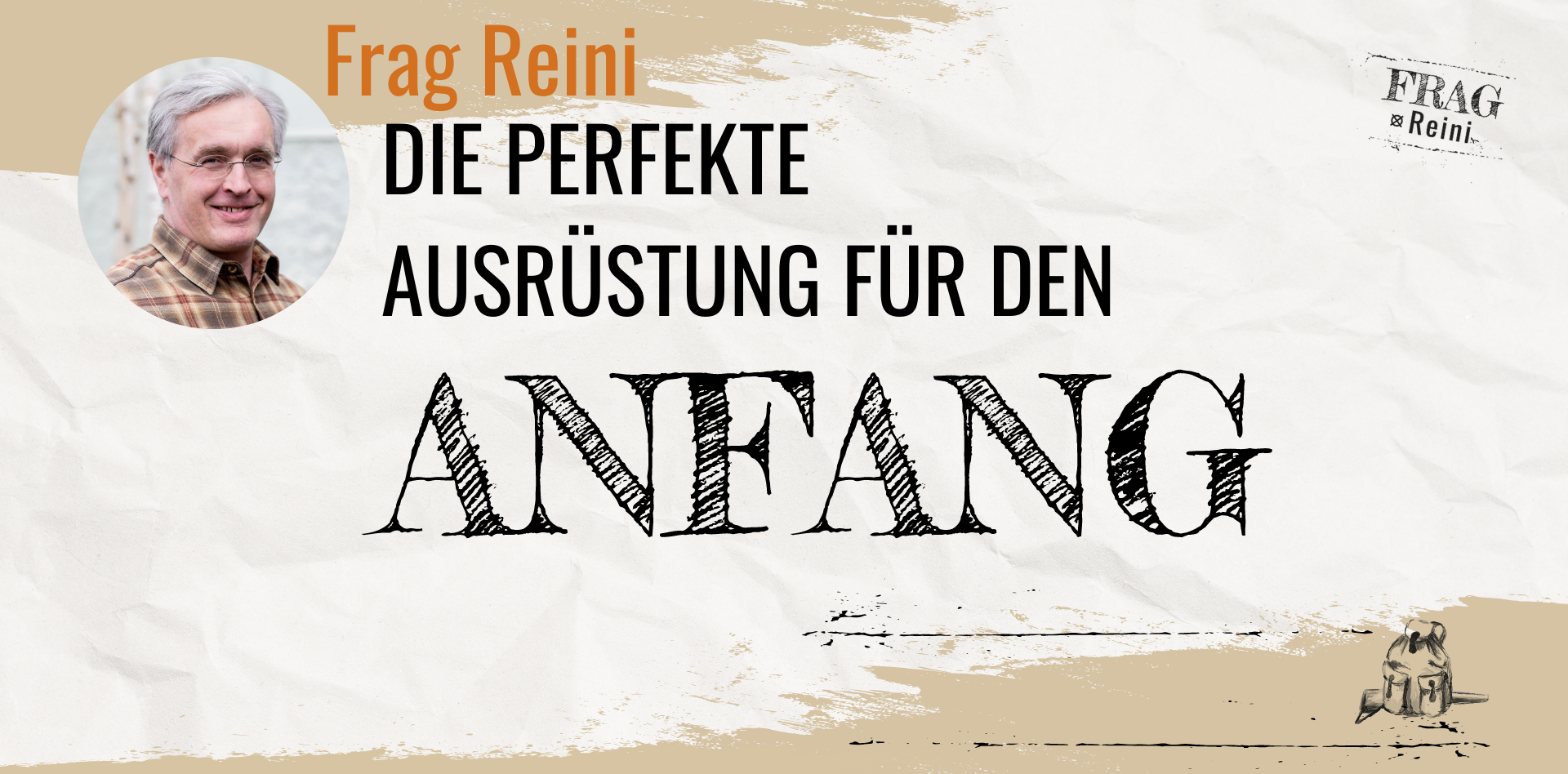Wildtiere des Alpenraums werden in den letzten Jahrzehnten mit sich wandelnden und neuen Lebensraumfaktoren, zunehmenden Stressoren sowie Krankheitserregern und Infektionsrisiken konfrontiert. Neben der ganzjährigen Mehrfachnutzung alpiner Lebensräume, dem An-steigen der Waldgrenze oder schwindenden optimalen Überwinterungsgebieten verursachen höhere Durchschnittstemperaturen oder Hitzeperioden auch eine Verminderung der Äsungsqualität. Diese gehaltsärmere und schlechter verdauliche Äsung führt zumindest bei Jungtieren, die sowohl noch wachsen müssen als auch Fettreserven für den Winter anlegen sollten, zu einem schlechteren Ernährungszustand im Herbst und damit zu höheren Fallwildverlusten im Winter.
Zunehmender Parasitendruck gemeinsam mit den z. T. immunsuppressiv wirkenden Störfaktoren und regional geänderten Düngeverfahren (Gülledüngung) wirken sich deutlich auf die Wildtiergesundheit, Fallwildraten und damit auf die Entwicklung von Populationen aus.
Einflüsse auf die Entwicklung von Gamsbeständen
Bestimmend für die Sterberate (Mortalitätsrate) sind die Faktoren Beutegreifer (Prädation), Witterung und Klima, Krankheiten, Unfälle und die jagdliche Entnahme. An Beutegreifern spielen vor allem Adler, Fuchs sowie – wo vorkommend – auch Luchs und Wolf eine Rolle. Witterung (kurzfristig) und Klima (über längere Zeiträume) haben einen Einfluss auf den Le-bensraum (z. B. Ansteigen der Waldgrenze durch den Klimawandel) oder auf die Äsungsqua-lität. Die Witterung im Winter/Nachwinter und nach der Setzzeit ist hauptverantwortlich für die Fallwildrate. Unfälle, etwa durch Steinschlag, Abstürze oder Lawinen, können auch direkt oder indirekt mit Witterungs- und Klimafaktoren zusammenhängen. Krankheiten können seu-chenhaft verlaufen, wie Gamsräude oder -blindheit, viele Krankheiten treten aber erst bei ne-gativen Umweltfaktoren klinisch auf („Faktorenkrankheiten“). Wenn die jagdliche Entnahme im kompensatorischen Bereich bleibt, wirkt sie nicht bestandsmindernd, aber additiv zu den anderen Faktoren und damit ist eine gewollte/ungewollte Bestandsreduktion zu erwarten.
Klimawandel und Krankheiten
Der Einfluss des Klimawandels auf die Verbreitung von Krankheitserregern kann einerseits direkt erfolgen, indem Krankheitserreger bei höheren Jahresdurchschnittstemperaturen in der Umwelt länger überleben und auch höheren Infektionsdruck erzeugen, oder andererseits auch indirekt bei jenen Krankheitserregern, die über Vektoren (z. B. Zecken, Stechmücken) über-tragen werden und deren Verbreitungsgebiet bzw. Populationsgrößen klimatisch beeinflusst werden. Erregerhaltige Zecken und Stechmücken sind bereits in größeren Seehöhen nachweisbar als noch vor zwei Jahrzehnten. Weiters können sich bei Krankheitserregern, die in ihrem Auftreten eine jahreszeitliche Periodik aufweisen, Zeiträume mit höherem Infektionsrisiko verlängern. Auch Parasiteneier und -larven sowie Zwischenwirte von Parasiten sind bereits in größeren Höhen nachweisbar bzw. profitieren von höheren Jahresdurchschnittstempe-raturen. In diesem Zusammenhang finden wir beispielsweise vermehrt eitrige Lungenentzündungen bei Gamswild in der Folge des Befalls mit Kleinen Lungenwürmern und sich sekundär aufpfropfenden bakteriellen Lungenentzündungen. Neben der Temperatur ist die Feuchtigkeit in der Losung und in deren Umfeld ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung von Parasiten. Auch hier gilt, dass Feuchtigkeit und Nässe in Zusammenhang mit geeigneten Temperaturen das Überleben der Parasiten begünstigen. Trockenheit und hohe Temperaturen töten parasitäre Stadien ab, ebenso wie direkte UV-Bestrahlung. Mit dem Ansteigen der Waldgrenze und zunehmendem Schattenwurf der Bäume kommt es auch dazu, dass weniger UV-Licht auf Parasiten und ihre Entwicklungsstadien in der Losung einwirken kann und diese somit länger infektiös bleiben.
Derzeit gibt es noch keine exakten Erkenntnisse über das Vorkommen von Endoparasiten bei Wildtieren abhängig von der Höhenlage. Es wurde jedoch erkannt, dass Parasiten wie der Große Leberegel, Labmagen-Dünndarm-Trichostrongyliden oder Lungenwürmer bei Wild-wiederkäuern zunehmend in höheren Lagen vorkommen, was auch im Rahmen unseres Gamswildprojektes „Modellregion Heiligenblut“ abzulesen war. Mittlerweile muss davon aus-gegangen werden, dass es im Zuge des Klimawandels, besonders in Jahren mit zeitigem Frühjahr und verzögertem Winterbeginn, zu einem deutlich gesteigerten Infektionsrisiko selbst in Höhenlagen von deutlich über 2.000 Metern Seehöhe kommen wird. Besonders überraschend an den Untersuchungen der letzten Jahre war der Nachweis des Roten Magenwurms (Haemonchus contortus), der in der Außenwelt wärmeliebend ist und beim Gamswild in alpinen Lebensräumen bis auf über 2.500 Metern Seehöhe in früheren Jahrzehnten noch keine Bedeutung hatte. Mittlerweile verursacht dieser Parasit regional teilweise erhebliche Ausfälle bei Gamswild, was möglicherweise auch mit der erst kurzen Koevolution zwischen Wirt und Parasit und damit Problemen der Immunabwehr zusammenhängen könnte. Der Rote Magenwurm, der Erreger der Haemonchose, lebt im Labmagen von Wild- und Hauswiederkäuern, ernährt sich von Gewebeteilen und saugt Blut aus der Labmagenschleimhaut. Durch das Saugen von Blut sowie infolge von Nachblutungen kommt es zu großen Blutverlusten und Anämie. So nehmen 1.000 Würmer rund 50 ml Blut pro Tag auf (ROMMEL et al., 2000). Bei der Sektion zeigen erkrankte Stücke blasse, blutarme Organe, Milzvergrößerung, Flüssigkeitsansammlung in Brust- und Bauchhöhle sowie tiefrotes Knochenmark. Neben dem Blutverlust kommt es aufgrund einer verminderten Salzsäureproduktion und einem Anstieg des pH-Werts im Labmagen zu Verdauungsstörungen, beispielsweise einer Störung der Eiweißverdauung. Die Haemonchose führt häufig zu schweren klinischen Erkrankungen und plötzlichen Verendensfällen.
Zecken als Krankheitsüberträger
Zecken sind neben Stechmücken in Mitteleuropa die bedeutendsten Überträger von Krankheitserregern (Viren, Bakterien und Parasiten) auf Menschen und Tiere. Der Klimawandel hat auch Einflüsse auf die Ökologie und Verbreitung dieser Vektoren, wie allein an der zunehmenden Verbreitung von Zecken in Hochlagen erkennbar ist. Zusätzlich ist mit dem Auftreten von bislang in Mitteleuropa nicht vorkommenden Zeckenarten zu rechnen.
Zecken übertragen eine Reihe bedeutender Infektionskrankheiten wie beispielsweise Borreliose, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Babesiose oder auch Tularämie. Die Verbreitung der weltweit rund 850 Zeckenarten ist vor allem von Witterungsfaktoren wie der Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. In trockenen Gebieten, die zukünftig noch weniger Niederschläge haben werden, wird das Infektionsrisiko vermutlich durch den Gemeinen Holzbock rückläufig sein, in anderen Gebieten deutlich zunehmen. Weiters sind Zecken auf geeignete Wirtstiere angewiesen, deren Verbreitungsgebiete jedoch ebenfalls klimaabhängig sind. Schildzecken werden rund fünf Jahre alt, Lederzecken sogar bis zu zehn Jahre. Mittlerweile ist ein Vordringen des Gemeinen Holzbocks (Ixodes ricinus) in unseren Breiten bis in Seehöhen zwischen 1.500 und 1.700 Metern und darüber hinaus bekannt. Für dieses Vordringen sind die milderen Winter mit einer geringen Anzahl von Tagen mit unter -12 °C verantwortlich. Es ist auch belegt, dass Zecken im Winter bei höheren Temperaturen aktiv bleiben und auf Wirts-suche gehen, unter 6-7 °C ziehen sich Zecken in die Laubstreu zurück und verweilen dort inaktiv, um sich vor Kälte zu schützen. In extrem milden Wintern kann die Winterruhe vollkommen ausfallen.
Zur Babesiose, verursacht durch einzellige Blutparasiten, die durch Zecken übertragen werden, liegen bei Wildwiederkäuern Untersuchungen aus der Schweiz vor. MICHEL et al. (2014) untersuchten die Rolle von Wildwiederkäuern als Wirte dieser zeckenübertragenen Parasitose. In 10,7 % von insgesamt 984 untersuchten Blutproben von Reh-, Rot-, Gams- und Steinwild aus der Schweiz konnten verschiedene Babesien (B. divergens, B. capreoli, Babesia sp. EU1, Babesia sp. CH1 und B. motasi) nachgewiesen werden. Bei fünf Tieren wurden zwei verschiedene Spezies detektiert. Mit dem Ansteigen der Temperaturen und damit der Zecken ist zukünftig sicherlich mit häufigeren Nachweisen bei Gams- und Steinwild zu rechnen, wie auch im Untersuchungsgebiet bei einem Fall in Judenburg/Steiermark auf einer Seehöhe von 1.500 Metern nachgewiesen wurde. Dieser Fall, übrigens der erste beschriebene klinische Fall bei Gamswild in Österreich, ist ein deutliches Zeichen des stattfindenden Klimawandels und seiner Auswirkungen auf Krankheitserreger und Krankheitsüberträger (hier Zecken). Glaubte man vor wenigen Jahrzehnten noch, dass zeckenübertragene Krankheiten lediglich bis zu einer Seehöhe von rund 1.000 Metern relevant seien, muss heute davon ausgegangen werden, dass diese Krankheiten bereits in deutlich höheren Lagen vorkommen, was infektionsgefährdete Gebiete wesentlich ausdehnt. Bei Rindern wurde die Babesiose bereits auf ca. 1.700 Metern nachgewiesen.
Hitzesommer
Hitzesommer, wie sie beispielsweise 2003 und 2013 zu beobachten waren, sind sowohl für Haus- als auch für Wildtiere ein enormer Stressfaktor. Nicht nur bei Rot- und Rehwild, son-dern auch beim Gamswild lagen die Durchschnittsgewichte aller Altersklassen im und nach dem Extremsommer 2003 durch Hitzestress und Wassermangel deutlich unter jenen der bei-den vorhergehenden Jagdjahre. Das Durchschnittgewicht von Gamswild war beispielsweise in der Steiermark um 0,5 kg niedriger. Im Herbst/Winter 2003 war allgemein eine Häufung von Paratuberkulosefällen bei Wild zu beobachten.
Lebensräume
Wildtierarten wie Gams- und Steinwild haben sich im Laufe ihrer Evolution perfekt an das Leben in alpinen Regionen angepasst und sind somit Teile dieses sehr empfindlichen Ökosys-tems geworden. Bei einem allgemeinen Ansteigen der Waldgrenze aufgrund der Klimaerwär-mung und einem regionalen Rückgang der Almbewirtschaftung verringert sich der Lebens-raum dieser Wildtierarten massiv. Durch das Entstehen suboptimaler Lebensräume kommt es zur Abnahme und zum Verschwinden einzelner Populationen, zur Verarmung genetischer Ressourcen, zur Schwächung der Abwehrlage und damit auch vermehrt zu Infektionskrank-heiten und Parasitosen.
Als Grundlage für die Ermittlung der Veränderungen wurde die Temperaturentwicklung der vergangenen 50 Jahre in einem Projektgebiet in den Niederen Tauern genauer betrachtet sowie das Klimamodell MM5 für eine Abschätzung der zukünftigen Erwärmung herangezogen (Schaumberger et al. 2006). Das Klimamodell prognostiziert für die nächsten 50 Jahre eine Erwärmung von ca. 2,2 °C für das Untersuchungsgebiet (mittlerweile wird bereits von einer wesentlich stärkeren Erwärmung ausgegangen). Das Baumwachstum ist sehr stark von der Temperatur abhängig und es wurde eine hohe Korrelation zwischen der Wachstumsgrenze von Bäumen und der 10 °C Juli-Isotherme (oder 6,9 °C Mai-Oktober-Isotherme) nachgewiesen. Das Klimamodell MM5 zeigt für die nächsten 50 Jahre einen prognostizierten Anstieg dieser Isotherme um ca. 450 Höhenmeter, was bedeutet, dass langfristig auch die Baumgrenze auf diese Höhe ansteigen wird. Auch kleinstandörtliche Gegebenheiten, im Speziellen das Mikro-klima in der Vegetation, üben einen starken Einfluss auf das Vorkommen von Pflanzen und Tieren aus.
Klimawandel und Vegetation
Phänologie ist die Wissenschaft, jährlich periodisch wiederkehrende Ereignisse bei Pflanzen und Tieren (wie das Entfalten der Blätter, Blüte, Fruchtreife oder die Ankunft von Zugvö-geln) zu erfassen. Der Anstieg der globalen Mitteltemperatur macht sich hier durch eine Ver-schiebung des jahreszeitlichen Zyklus von Pflanzen und Tieren hin zu früheren Beginnzeiten im Frühling und zu einem späteren Ende der aktiven Zeit im Herbst bemerkbar. Seit den frü-hen 1960er-Jahren hat sich laut Untersuchungen im Rahmen des (europaweiten) Netzwerks phänologischer Gärten die Länge der Vegetationsperiode durchschnittlich um ca. zehn Tage erhöht, davon sechs Tage im Frühjahr und vier im Herbst. Pflanzen und Tiere können grund-sätzlich auf drei Arten auf Änderungen der Umweltbedingungen bzw. dadurch verursachten Stress reagieren:
1. Ausharren unter den geänderten Bedingungen (Stress-Toleranz)
2. Abwandern in Gebiete mit besser passenden Bedingungen (Stress-Vermeidung) oder
3. Aussterben
Die prognostizierten Änderungen der klimatischen Standortsbedingungen beeinflussen auch die chemische Zusammensetzung der Pflanzen, die sich wiederum direkt auf die Äsungs-/Futterqualität auswirkt. Eine der wichtigsten Ursachen der Klimaänderungen ist die Erhö-hung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Dieses Gas spielt für die Pflanzen bei der Photosynthese eine zentrale Rolle und so hat dieser Parameter auch Auswirkungen auf die Pflanzen. Generell profitieren speziell Gräser von mehr CO2, es kann aber auch zu Problemen führen, da durch mehr CO2 der vorhandene und begrenzte Stickstoff im Pflanzengewebe sozusagen „verdünnt“ werden könnte, die Blätter also weniger Stickstoff (Rohprotein) enthal-ten, was zu einem erhöhten Fraß-/Äsungsdruck führen würde, da die Pflanzenfresser dieselbe Menge an Stickstoff (Proteine) aufnehmen müssen. Ebenso werden auch sekundäre Pflanzen-stoffe wie Tannine beeinflusst, deren geänderte Konzentration wiederum die Verdaulichkeit der aufgenommenen Biomasse beeinflusst.
Im Zeitraum zwischen 1993 und 1997 wurden auf ehemals insgesamt 16 Almflächen in der Obersteiermark vor allem der Ertrag und die Futterqualität von Almweiden erfasst. Ergänzen-de Untersuchungen zeigten schon damals den Einfluss der Vegetationsdynamik auf die Fut-terqualität. Die 16 Versuchsstandorte wurden gleichmäßig nach den Standortfaktoren Seehö-he, Exposition und Grundgestein ausgewählt, die Standorte verteilten sich auf 1.100, 1.300, 1.500 und 1.700 Meter. Die ursprünglichen Flächen wurden 2014 und 2015 im Rahmen des Projekts „StartClim2014.D“ in kleinerem Maßstab wiedereingerichtet und erneut auf Futter-qualität und botanische Zusammensetzung überprüft (DEUTZ et al., 2015). Zwischen dem Erntetermin und dem damit verbundenen Reifestadium sowie dem Rohfasergehalt besteht eine enge Beziehung. Die phänologische Entwicklung der Pflanzenbestände zeigt eine Ge-schwindigkeit von rund 17 Metern Seehöhe pro Tag und die Rohfaserzunahme beträgt 1 g Rohfaser pro Tag. Unter Annahme einer Temperaturerhöhung in wärmeren Sommern um 1,7 °C würde der Almsommer im Untersuchungsgebiet im Mittel um rund drei Wochen früher beginnen. Dies bedeutet eine Zunahme des Rohfasergehalts um 22 g/kg Futtertrockenmasse und damit eine schlechtere Verdaulichkeit der Äsung besonders für Jungtiere. Durch eine schlechtere Ernährungssituation wird die körperliche Entwicklung gehemmt und die Krank-heitsanfälligkeit alpenweit gesteigert. Zudem treten Hitzestress und zwischenartliche Konkur-renz zwischen beispielsweise Rot- bzw. Stein- und Gamswild auf.
Folgen suboptimaler Lebensräume
Änderungen im Klima und in der Umwelt hatten in den letzten Jahrzehnten bei unterschiedli-chen Tierarten einen Einfluss auf die Körpergröße. Die meisten Studien vermuteten indirekte Einflüsse des Klimas auf die Verfügbarkeit der Ressourcen. MASON et al. (2014) beschrei-ben einen Rückgang des Körpergewichts beim Gamswild (Rupicapra rupicapra) in drei be-nachbarten Populationen in den italienischen Alpen und fanden deutliche Hinweise, dass hö-here Temperaturen im Frühling und Sommer dafür verantwortlich sind. Und zwar nicht haupt-sächlich wegen der Einflüsse des Klimawandels auf die Produktivität und Phänologie der Pflanzenbestände, sondern deshalb, weil bei hohen Temperaturen und dem damit verbunde-nen Meideverhalten von zu warmen Lebensräumen weniger Zeit für die Äsungsaufnahme aufgewendet wird. Durch Managementmaßnahmen könnten geeignete Äsungsgebiete vergrö-ßert werden, um diesem Trend zu begegnen.
Mögliche Strategien
Wirksame Gegenstrategien und Maßnahmen gegen eine Verschlechterung der Lebensbedin-gungen von Wildtieren im Alpenraum und eine Zunahme von Krankheiten bei Wildtieren bzw. eine geänderte Raumnutzung von Wildtieren mit möglicherweise erhöhtem Infektions- sowie Schadensdruck auf die Waldvegetation können nur erfolgreich sein, wenn sie interdis-ziplinär angestrengt werden.
Aus landwirtschaftlicher Sicht wurden u. a. Auf- und Abtriebzeitpunkte von Weidevieh, Dichte der Bestoßung der Almflächen, Entwurmung von Weidevieh, Düngungsmanagement (Gülle auf Almflächen!?), Maßnahmen gegen das Zuwachsen von Almflächen durch Anstei-gen der Waldgrenze und das Förderwesen diskutiert. Seitens der Forstwirtschaft wurden das Schwenden, ein Waldgams-Verbissschutz und die Schadensanfälligkeit der Wälder angespro-chen. Seitens der Jagd ging es u. a. um nachhaltige Abschussplanung bei Gams- und Stein-wild unter Berücksichtigung der aktuellen Fallwildraten, besseren Altersklassenaufbau (aus-reichend alte, erfahrene Stücke = Erfahrungsträger, Erhaltung einer möglichst großen geneti-schen Breite; kein Abschuss nach engen Selektionskriterien, da es zukünftig vielleicht gegen-über den heute vorwiegend auftretenden Genvarianten z. B. bei Gamswild andere brauchen könnte, um sich besser auf geänderte Umweltbedingungen einstellen können), frühzeitige Ab-schusserfüllung und Rotwildregulierung. Aus veterinärmedizinischer und wildbiologischer Sicht wäre es im Zusammenhang mit Wildkrankheiten wichtig, effiziente Informationssyste-me über Wildbestände, auftretende Krankheiten und jagdliche Eingriffe einzurichten, erkrank-te und verdächtige Stücke verstärkt zu untersuchen, Wildbestände an den jeweiligen (Winter-)Lebensraum anzupassen, die Freizeitnutzung zu lenken, den Jagddruck im Winter zu reduzie-ren und Wildruhezonen einzurichten.
TEXT: Dr. Armin Deutz