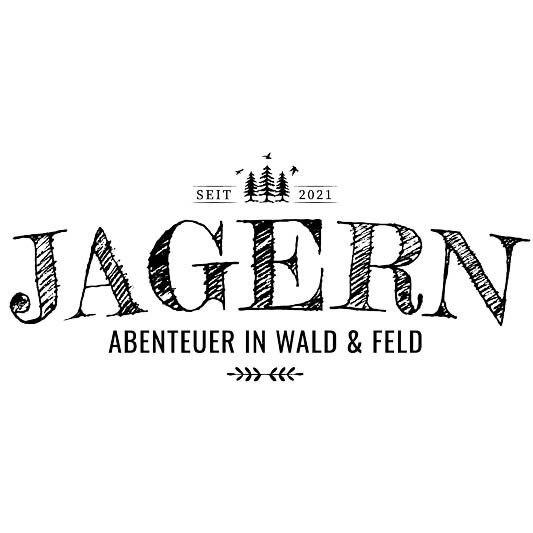Funktion einer Wildblumenwiese im Ökosystem
Lebensraum für Insekten
Durch ihre Vielfalt an Blütenpflanzen stellen Blühwiesen während der gesamten Vegetationsperiode Pollen und Nektar für viele Insektenarten bereit. Diese kontinuierliche Futterquelle ist entscheidend für den Erhalt stabiler Insektenpopulationen.
Nahrungskette und Artenvielfalt
Insekten auf Wildblumenwiesen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Nahrungskette. Sie dienen als Nahrung für Feldvögel wie Rebhuhn, Fasan und Wachtel sowie für Kleinsäuger und Amphibien, und sogar Wildtiere wie Fuchs und Dachs ernähren sich häufig von Insekten. Auch die Samen und Kräuter der Wiesenpflanzen sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Wildtiere und Vögel. Durch diese komplexen Wechselwirkungen fördern Wildblumenwiesen die Biodiversität und die im Revier vorhandene Artenvielfalt.
Bodenverbesserung und Wasserregulierung
Die tiefen Wurzeln vieler Wildblumen lockern den Boden, verbessern die Bodenstruktur und fördern damit die Wasserspeicherung. Diese Eigenschaften reduzieren die Gefahr von Bodenerosion und tragen zu einem stabilen Mikroklima bei.
Kohlenstoffspeicherung und Klimaschutz
Wildblumenwiesen tragen, wenn auch in geringerem Umfang, zum Klimaschutz bei. Durch die Biomasseproduktion und die Speicherung von Kohlenstoff in Wurzeln und Pflanzen leisten diese einen Beitrag zur Minderung des Klimawandels.
Mehrwert für die Jagd
Für die Jägerschaft sind Wildblumenwiesen ein wertvolles Werkzeug, um Lebensräume zu verbessern und die Hege zu fördern. Verschiedene Wiesentypen können gezielt angelegt werden, um bestimmte Wildarten zu unterstützen:
- Rebhühner und Wachteln profitieren von Magerrasen oder Blühstreifen mit offenen Bodenstellen.
- Hasen finden in Fettwiesen und blütenreichen Streifen sowohl Deckung als auch Nahrung.
- Viele Schalenwildarten finden auf den Wiesen ein reiches Angebot an Kräutern und nährstoffreichem Futter.
Gerade für Niederwildarten in stark landwirtschaftlich geprägten Revieren sind solche Blühflächen in Kombination z. B. mit Hecken und Gräben oft überlebenswichtig. Sie bieten Rückzugsräume mit ausreichendem Nahrungsangebot. Hier ist auch die Art der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wichtig. In Grünlandgebieten stehen fast ausschließlich Blühflächen als Möglichkeit zur Verfügung, in Ackergebieten kann dies auch über die Fruchtfolge und z. B. Winterbegrünung differenziert werden.
Wie legt man eine Wildblumenwiese an?
Die gute Nachricht: Die Anlage einer Wildblumenwiese ist in vielen Fällen einfacher als man erwarten würde und erfordert meist keine großen technischen Voraussetzungen. Entscheidend sind vor allem die richtige Standortwahl und damit einhergehend die Vorbereitung des Bodens und die Auswahl einer geeigneten Saatgutmischung.
1. Den richtigen Standort wählen
Wildblumenwiesen gedeihen auf mageren, nährstoffarmen Böden anders als auf guten Böden. Man sollte darüber hinaus einen sonnigen Standort wählen, da die meisten Blühpflanzen viel Licht benötigen. Es gibt nicht „die“ eine Wildblumenwiese – je nach Standort, Bodenbeschaffenheit und Nutzung entwickeln sich unterschiedliche Typen. Diese Vielfalt ist wichtig, da jeder Typ spezifische Pflanzen- und Tiergemeinschaften unterstützt. Deshalb ist es für die erfolgreiche Anlage einer solche Wiese zentral, die Standortfaktoren genau zu berücksichtigen. Hier im Überblick einige typische Standorte und deren Ausprägung.
Magerrasen (Trockenwiese)
Standort: magere, nährstoffarme Böden, oft in sonnigen, trockenen Lagen z. B. Wegränder, Böschungen oder sandig-schlottrige Bereiche
Magerrasen sind geprägt von einer hohen Pflanzenvielfalt, darunter oft Schafgarbe, Wiesensalbei, Thymian und Margerite. Sie bieten idealen Lebensraum für Wildbienen und Schmetterlinge wie den Schwalbenschwanz. Diese Wiesen sind Rückzugsräume für Arten, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind.
Feuchtwiesen
Standort: nährstoffreiche, feuchte Böden, oft in Auen oder sumpfigen Senken
Typische Pflanzen sind hier Sumpfdotterblume, Mädesüß und Kuckucks-Lichtnelke. Diese Wiesen sind häufig von Seggen und Binsen dominiert. Feuchtwiesen sind besonders pflegeintensiv, da sie ohne regelmäßige Mahd oder Beweidung leicht verbuschen. Sie bieten Lebensraum für Amphibien wie Frösche und Molche und sind ein wichtiges Brutgebiet für Wiesenvögel wie die Bekassine.
Blumenreiche Fettwiesen
Standort: nährstoffreiche Böden, häufig auf extra dafür angelegten landwirtschaftlichen Flächen, die weniger gedüngt werden als jene für die Futtererzeugung
Artenreiche Fettwiesen sind oft blütenreich und beherbergen Arten wie Glockenblume, Wiesenschaumkraut und Rotklee. Diese Wiesen bieten Deckung und Nahrung für Wildtiere wie Reh und Feldhase.
Brachflächen und Blühstreifen
Standort: oft an Wegrändern, Ackerrändern oder auf Brachflächen
Hier dominieren Wildblumen, die sich schnell ansiedeln, wie Mohn, Kornblume und Kamille. Ruderalflächen sind besonders für Wildbienen und Ackerwildkräuter wichtig, haben aber eine geringere langfristige ökologische Stabilität. Diese Flächen können jedoch einfach und schnell geschaffen werden. Vor allem entlang von Forststraßen bietet sich die Schaffung solcher Flächen an.
Hat man den richtigen Standort für die Anlage einer solchen Wiese bei sich im Revier gefunden, geht es an die Bodenvorbereitung und Ansaat. Oft können für die Anlage von Wildblumenwiesen landwirtschaftlich weniger ertragreiche Flächen verwendet und diese dadurch für die Wild- und Tierwelt aufgewertet werden. Brach- oder Ruderalflächen sind hier besonders gut geeignet.
2. Boden vorbereiten und Saatgut wählen
Der Boden sollte von Unkraut und Grasfilz befreit werden. Bei nährstoffreichen Böden ist es erforderlich, den Boden umzubrechen, um optimale Bedingungen für die Keimung von besonderen Blühpflanzen zu schaffen. Die Wahl des Saatguts ist dabei entscheidend. Viele der im Handel erhältlichen Saatgutmischungen bestehen oft aus Ackerblumen wie Klatschmohn und Kornblume oder enthalten sogar exotische Arten aus nordamerikanischen Prärien, welche nicht in unsere heimischen Ökosysteme gehören. Diese Pflanzen blühen zwar schnell und üppig, sind jedoch überwiegend einjährig und müssen jedes Jahr neu ausgesät werden.
Wichtig ist ein rund 10 Zentimeter tief bearbeitetes und feines Saatbett, um die Altnarbe bestmöglich einzuarbeiten und eine optimale Keimung des Saatguts zu gewährleisten. Eine einfache Übersaat ist nicht zielführend, da sich ansonsten der Altbestand zu stark durchsetzt. Die langsam keimenden Samenkörner sind größtenteils Lichtkeimer und werden vom schattenwerfenden Altbestand unterdrückt. Maschinell ist dies mit einer (Umkehr-)Rotoregge, einer (Umkehr-)Fräse oder einem Pflug mit anschließender Saatbettbereitung möglich.
Ziel soll jedoch eine oberflächliche Bodenbearbeitung bleiben. Der fruchtbare Oberboden eines Dauergrünlandes soll nicht zu tief vergraben werden.
3. Aussaat
Die beste Zeit für die Aussaat ist im April und Mai, da bei späterer Aussaat sonst schnell wachsende Gräser die Wildblumen verdrängen können. Je nach Mischung benötigt man etwa 2 bis 5 Gramm Saatgut pro Quadratmeter. Da diese geringe Menge ohne Saatmaschine schwer gleichmäßig zu verteilen ist, empfiehlt es sich, das Saatgut z. B. bei Anlage im Wald mit trockenem Sand oder Sägemehl zu mischen.
4. Pflege der Fläche
Eine Wildblumenwiese benötigt wenig Pflege. Einmal etabliert, wird die Wiese gemäht, wenn die meisten Wildblumen Samen gebildet haben. In vielen Wiesen ist die Margerite eine geeignete Zeigerart. Damit die Samen ausfallen, sollte das Schnittgut zwei bis drei Tage auf der Fläche getrocknet, dann aber entfernt werden, denn Mulchen würde zu einer unerwünschten Nährstoffanreicherung führen. Ein- bis zweimaliges Mähen pro Jahr reicht aus, um die Artenvielfalt zu fördern.
Für die tierischen Bewohner von Wiesen bringt die Mahd eine plötzliche und drastische Veränderung ihres Lebensraums mit sich. Dies äußert sich durch den Verlust von Nahrung, Deckung und Schutz vor Witterung. Zusätzlich besteht ein erhebliches Risiko durch die eingesetzten Mähgeräte. Insbesondere rotierende Maschinen wie Scheiben- und Kreiselmähwerke verursachen deutlich mehr Schäden als schneidende Geräte wie Sensen oder Messermähwerke. Deshalb sollten artenreiche Wiesen unbedingt mit schneidenden Geräten gemäht werden.
Eine Schnitthöhe von etwa 10 Zentimetern hilft dabei, viele Tiere sowie die Blattrosetten der Wildblumen zu schonen.
Eine mosaikartige Mahd, bei der Teilflächen zeitlich versetzt an zwei bis drei verschiedenen Terminen gemäht werden, bietet Rückzugsräume für Tiere und stellt sicher, dass Blütenbesucher kontinuierlich Nahrung finden. Auf Standorten mit unterschiedlichen Verhältnissen können zudem einmähdige Flächen mit solchen, die zwei- bis dreimal jährlich gemäht werden, kombiniert werden. Besonders wertvoll sind Randbereiche, die nur alle zwei Jahre gemäht werden. Sie entwickeln sich zu wichtigen Lebensräumen mit Hochstauden, die vielen Kleintieren eine Überwinterungsmöglichkeit bieten.
Fazit
Die Anlage von Wildblumenwiesen ist nicht nur ein Gewinn für das Wild und das Revier, sondern auch ein starkes Zeichen für die Verantwortung der Jägerschaft. Mit wenig Aufwand können Jäger viel für die Biodiversität und die Lebensräume in ihrem Revier tun – zum Wohl der Wälder, der Wiesen, des Wildes und der kommenden Generationen.
Ganz nach dem Motto „Don’t worry, be(e) happy!“