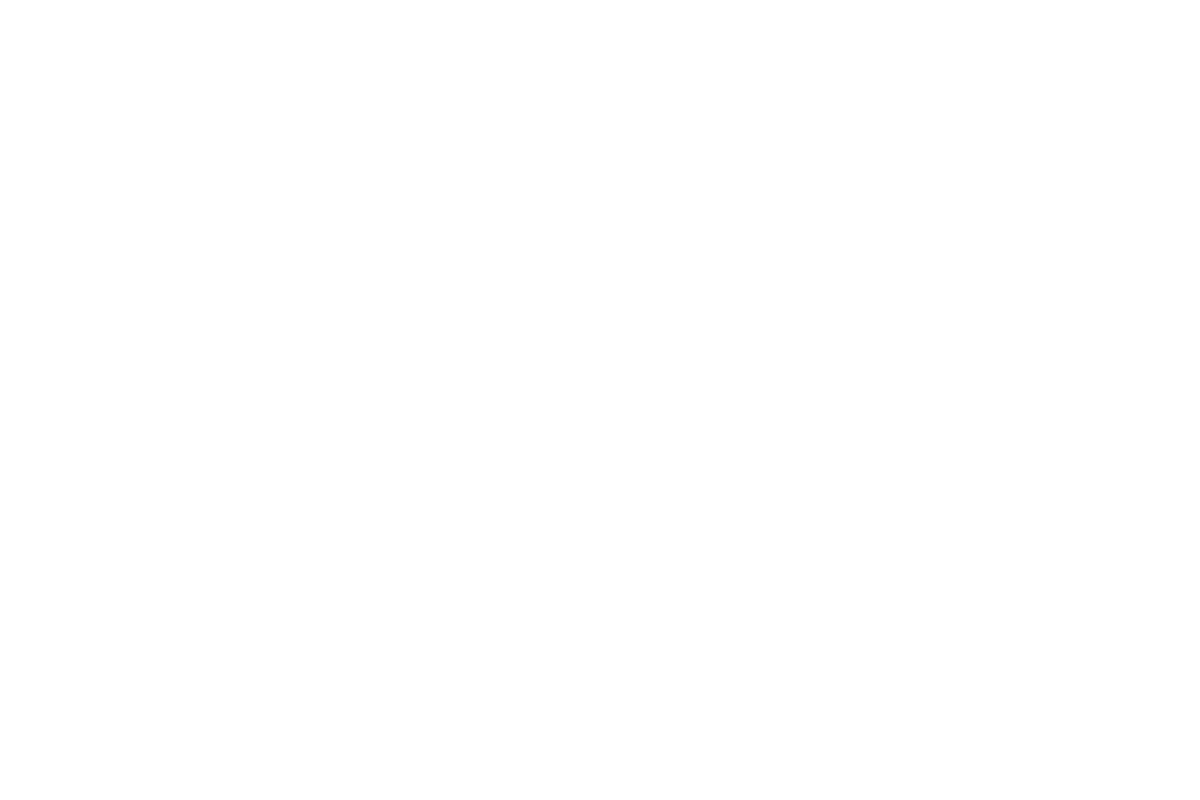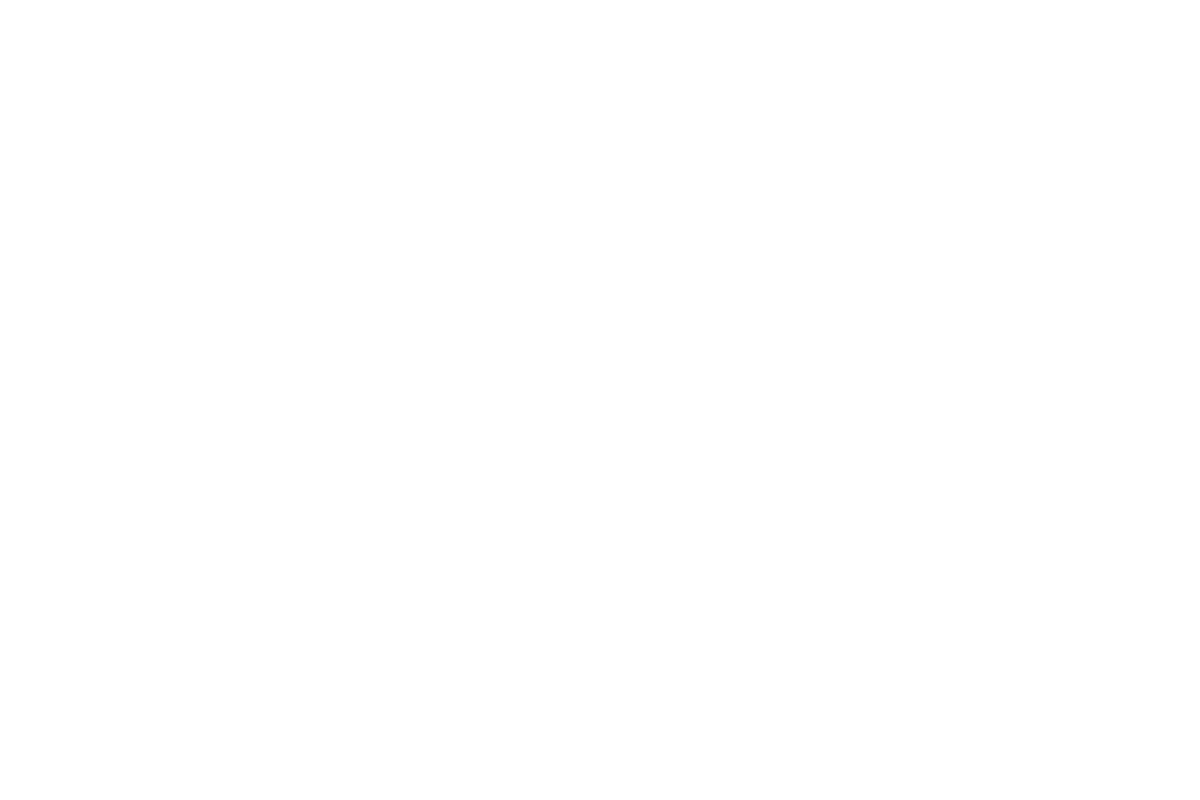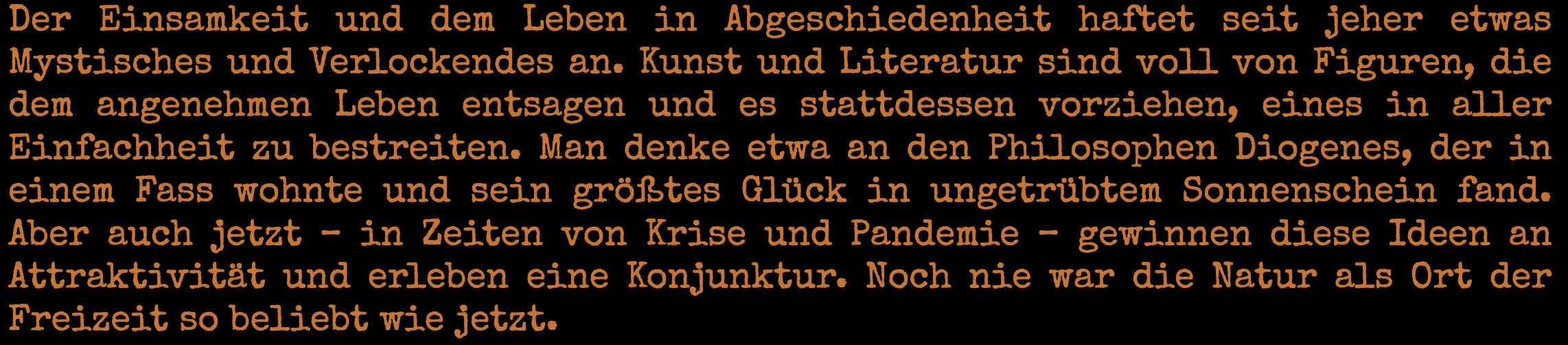

Aber kann das so einfach gehen?
So schier unendlich die Zahl dieser Veröffentlichungen ist, in einem Punkt gleichen sich die meisten doch: Zivilisation und Natur werden dabei als Gegenpole begriffen, die sich unvereinbar gegenüberstehen. Entscheide ich mich für das eine, muss ich dem anderen entsagen und vice versa. Man läuft dabei aber Gefahr, in ein zu einfaches Betrachtungsschema zu verfallen, in der die Welt nur mehr in Schwarz oder Weiß existiert. Verdächtig erscheint es dann, wenn man sich dabei ertappt, die Annehmlichkeiten einer modernen Welt – die es ja zweifelsfrei gibt – zu genießen.
Vielmehr gilt es zu sehen, dass die Natur als Ort der Ruhe nicht denkbar ist, wenn es nicht die hektische Stadt als ihr Gegenstück gibt. Erst dadurch wird Ruhe und Abgeschiedenheit erstrebenswert. Das gilt aber auch umgekehrt! Man sieht also, dass eine strikte Trennung dieser Bereiche die Misere eher verstärkt, denn lindert. Vielmehr gehen sie fließend ineinander über – sie bedingen sich gegenseitig.
Der oben zitierte Autor Henry David Thoreau ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein striktes „entweder – oder“ mitnichten die beste Betrachtungsweise ist. Es war die Einsamkeit der Blockhütte, die Ruhe und die Spaziergänge im Wald auf der einen Seite, die „Walden“ zu so einem großartigen Werk machten. Auf der anderen Seite wäre dies aber nicht möglich gewesen, wenn Thoreau nicht nach zwei Jahren wieder „zurückgekehrt“ wäre in die Zivilisation. Erst der Kontrast, der Austausch mit anderen Menschen und die Kulturtechnik des Schreibens ließen ihn sehen, was das spartanische Leben fernab von allen Annehmlichkeiten auszeichnete.
Thoreau ist hier nicht allein. Zwei der ganz großen Philosophen des 20. Jahrhunderts praktizierten eine ähnliche Arbeitsweise. So zogen sich Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein regelmäßig in entlegene Hütten zurück, um dort konzentriert zu arbeiten. Martin Heidegger etwa verfasste einen großen Teil seines Hauptwerks „Sein und Zeit“ (1927) in einer schlichten Holzhütte im Schwarzwald nahe des Ortes Todtnauberg. Wittgenstein wählte für sich das Ende des Sognefjords in Norwegen als persönliches Refugium. Es wird berichtet, dass er sein 7 x 8 Meter großes Holzhäuschen nur einmal pro Woche verließ, um einzukaufen. Den Rest der Zeit verbrachte er mit seinen Studien und durchstreifte die unberührte Natur Skandinaviens. Man muss dabei aber der Vorstellung, dass erst eine „naive Weltflucht“ geniale Gedanken ermöglicht, kritisch gegenüberstehen. Man muss auch die andere Hälfte des Bildes sehen. Allein zusammen mit Institutionen der „modernen“ Welt wie Universitäten, Diskussionen mit Kollegen oder der Zugang zu Bibliotheken und Wissen, die den Phasen der Ruhe vorausgingen, kann eine solche „archaische“ Lebensweise Früchte tragen.
Das Leben dieser Philosophen mag uns aus vielerlei Gründen fernliegen. Dennoch können auch wir etwas daraus lernen. Möglicherweise hat sogar schon der eine oder andere – bewusst oder unbewusst – eine ähnliche Erfahrung gemacht. Momente der wohltuenden Einsamkeit, in denen man am eigenen Leib erfahren hat, wie positiv sich eine Zeit in Abgeschiedenheit und Ruhe, vielleicht eine mehrtägige Wanderung oder ein langer Tag im Revier, auf den Alltag auswirken kann. Sei es, dass man wieder an Gelassenheit gewonnen hat oder Dinge, die einem Kopfzerbrechen bereitet haben, plötzlich aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Aber auch auf den Umgang miteinander, in der Familie, im Freundeskreis oder in der Arbeit kann so eine „Weltflucht“ oder besser gesagt, was man bei dieser erlebt hat, Auswirkungen haben. Das alles sind aber Erkenntnisse, die man gewinnt, wenn man den Weg „zurück“ antritt. Erst durch den Abgleich mit dem Gewohnten, gewinnen diese Bilder an Farbe.
Man denke zum Beispiel an eine Jagdhütte, ganz gleich ob in den Bergen oder im Wald. Wenn man diese am Ende eines anstrengenden Tages, den man mit Wandern, Arbeiten im Revier oder Jagen verbracht hat, erreicht, ist das immer wieder ein besonderer Moment. Wo im Alltag oft kleine Differenzen zwischen Menschen für Reibung sorgen oder sogar zu Konflikten führen können, scheint es, als ob dort alle Gräben zugeschüttet seien. Man begegnet sich dort wertschätzend und offener, weil man von den Strapazen Bescheid weiß, die man durchmachen musste, um dorthin zu gelangen. Gemeinsam genießt man dann den Ausblick, den Sonnenauf- oder -untergang oder ein gemeinsames Getränk und erzählt sich, was man bei den Streifzügen durch das Revier gesehen und erlebt hat. Man selbst befreit sich vom gedanklichen Ballast; die eigene Wahrnehmung gewinnt an Fokus.
Von außen mag dieses Bild einer „Hüttengemeinschaft auf Zeit“ fast kitschig und surreal wirken. Ein Ideal, das mit dem oftmals grauen Alltag unvereinbar scheint. Genau darin liegt aber der Schatz einer temporären „Weltflucht“. Es geht nicht darum, diese beiden Welten einander anzugleichen. Ein solches erzwungenes Unterfangen ist zum Scheitern verurteilt. Vielmehr sollte es darum gehen, angenehme und positive Erfahrungen und Momente von der einen in die andere Sphäre „mitzunehmen“ und aus ihnen zu lernen. Zu versuchen die persönlichen Erkenntnisse in den Alltag zu integrieren, sollte die Idee sein, nicht sie gegeneinander auszuspielen. Das geht aber nur, wenn man die Zeit in der Natur, die Stunden in einer Hütte vor dem Kamin als Ergänzung des täglichen Lebens sieht und nicht als deren Antithese. Konkret kann sich das äußern, wenn man bei fordernden Situationen im Alltag versucht, einen Schritt zurückzutreten, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Aufgaben Schritt für Schritt erledigt und seine ganze Konzentration auf den Gegenstand richtet, im Umgang mit seinen Nächsten auch einmal die metaphorischen Gräben überwinden und elegante Schlichtheit praktizieren – so wie in einer Jagdhütte eben.