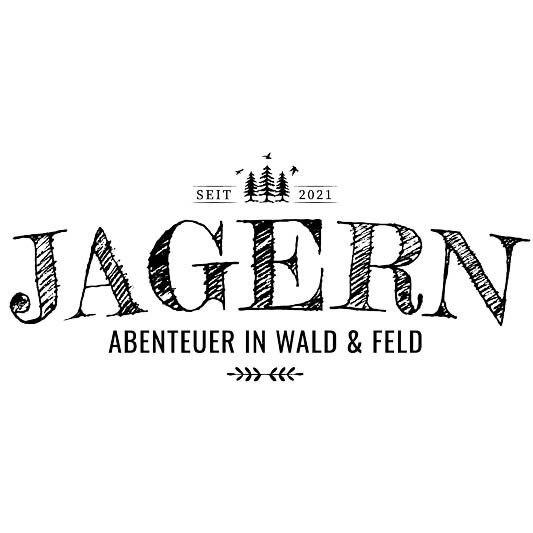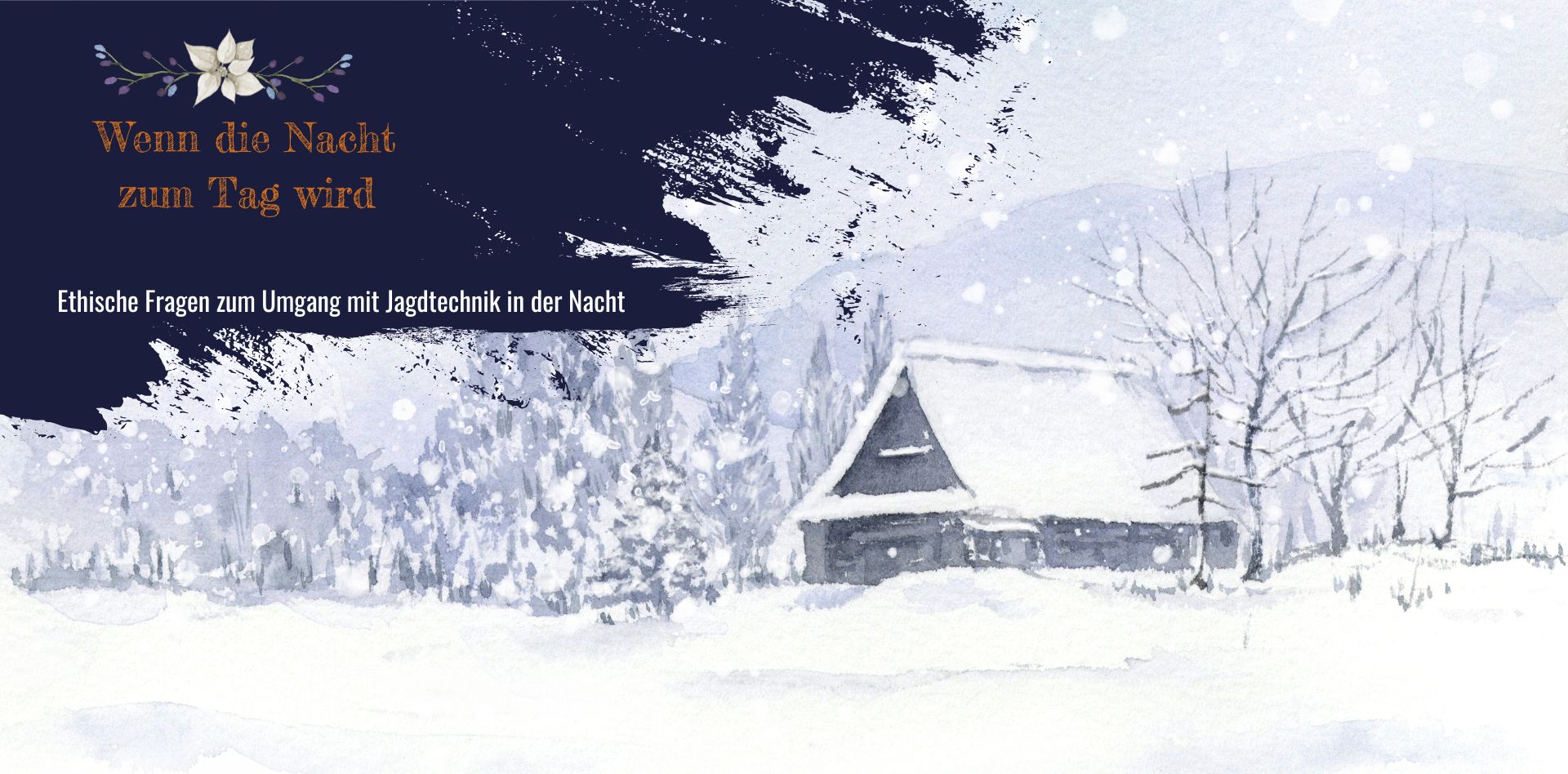Kontroverse Sichtweisen
Es scheint, dass sich beim Verwenden von Nachtsichtgeräten und Wärmebildtechnik in der Jägerschaft unterschiedliche Positionen gegenüberstehen. Es gibt jene, die das Verwenden derartiger Geräte für Jagdzwecke entschieden ablehnen, und es gibt andere, für die der Einsatz moderner Technik offenbar nicht weit genug geht. Schon hier wird deutlich: Es gibt Gesprächsbedarf und es braucht eine möglichst gemeinsame Linie, die nicht nur Jagderfolg und Abschusszahlen in den Blick nimmt, sondern aus einer ethischen Perspektive vor allem das Wohl der Wildtiere nicht vergisst.
Ist das noch Jagd?
Von dem spanischen Philosophen José Ortega y Gasset stammt der Gedanke, dass man dem Wild bei der Jagd auch eine Chance zum Entkommen lassen sollte. Für den Jagdphilosophen ist dies eine Frage der Fairness. Es ist klar: Je besser der jagende Mensch ausgerüstet ist und je mehr Technik zum Einsatz kommt, desto geringer ist die Chance des Wildtieres auf eine erfolgreiche Flucht. Stehen Abschusszahlen und Abschussplan allein im Vordergrund, wird man Ortega y Gassets Aussage als überwundene Ansicht abtun können. Doch ich meine, dass es sich lohnt, über die Worte des Philosophen etwas genauer nachzudenken und die Frage der Fairness gegenüber den Wildtieren bei der Jagd zu diskutieren. Denn diese Frage führt bei genauerer Überlegung zu dem, was man als „Selbstverständnis der Jagd“ bezeichnen könnte. Wie versteht sich der jagende Mensch selbst? Sieht er seine Aufgabe vor allem im Erlegen des Tieres oder geht es bei der Jagd auch um andere Werte wie das lange Ausharren und Anpirschen, bei dem der Jäger unter Umständen auch leer ausgehen kann und sich mit den Herausforderungen der Natur auseinandersetzen muss? Es tut gut, sich über diese Fragen auszutauschen und sich selbst darüber Gedanken zu machen. Soll es beispielsweise so sein, dass man den besten Hirsch schon in der Nacht ausmachen kann, um ihn dann beim ersten Tageslicht vor den anderen zu erlegen?
Ein fairer Umgang mit Mensch und Tier
Fairness ist für den Philosophen John Rawls ein wesentlicher Aspekt von Gerechtigkeit. Rawls hat seinen Gerechtigkeitsbegriff zwar für die menschliche Gemeinschaft entwickelt, doch es gibt immer mehr Versuche, den Ansatz auch auf den Umgang mit Tieren anzuwenden. Versucht man, das Konzept der Weidgerechtigkeit heute mit neuen Inhalten zu füllen, könnte dieser Aspekt des fairen Umgangs mit dem Tier integriert werden. Die Fairness gilt es aber nicht nur in Hinblick auf die Wildtiere zu verstärken, sondern auch im Kontext der anderen Jägerinnen und Jäger. Das Erwerben von gut funktionierenden Geräten, mit denen auch in der Nacht gejagt werden kann, ist zuerst einmal eine finanzielle Frage. Nicht jede jagende Person kann sich ein solches Instrument leisten. Wenn es nun einige Weidleute gibt, die hochgerüstet mit bester Technik ihre Jagden ausüben, während andere mit althergebrachten Methoden jagen, kann dies Streitigkeiten innerhalb der Jägerschaft befeuern. Auch dieser Aspekt muss beim Einsatz von Nachtsichtgeräten zu Jagdzwecken berücksichtigt und sollte innerhalb der Jägerschaft ausdiskutiert werden. Wo das nicht passiert, kann dies zu Unmut und Konflikten führen, die dann im Untergrund weiterbrodeln.
Der tierethische Aspekt
Der ethische Aspekt in der Bejagung von Wildtieren integriert den Tierschutzgedanken in die Jagdpraxis. Ausgehend davon ist die Nachtjagd kritisch zu betrachten. Aufgrund der Jagd und verschiedener menschlicher Einflüsse haben bestimmte Wildtiere wie beispielsweise das Rotwild ihre Aktivität in die Nacht hinein verlegt. Wenn nun auch in der Nacht bejagt wird, nimmt man dem Wildtier einen weiteren Ruheraum, weshalb sich beispielsweise die Deutsche Wildtierstiftung klar dafür ausspricht, das Nachtjagdverbot einzuhalten (https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/rothirsch-und-mensch). Dies gilt es auch bei der Beobachtung mit dem Nachtsichtgerät zu berücksichtigen. Denn allein schon das Auftreten des Menschen im Wildtierlebensraum während der Nacht kann das Verhalten der Tiere beeinflussen und zu Störungen führen. Das Monitoring von Wildtieren muss aus diesem Grund möglichst störungsarm durchgeführt werden.
Schusszeiten nicht übermäßig ausdehnen
Nachtsichtgeräte und Wärmebildtechnik ermöglichen es, die Schusszeiten auszudehnen und selbst beim immer späteren Austreten von Wildtieren einen gezielten Schuss anzubringen. Zwar ist die Technik so weit fortgeschritten, dass ein gezielter Abschuss möglich ist, das Ausdehnen der Schusszeiten drängt die Tiere als Folge einer Art Ruhestörung aber weiter in die Nacht hinein. Das Ansprechen des Wildtieres sollte deshalb idealerweise im letzten Tageslicht geschehen, nicht aber erst bei völliger Dunkelheit.
Technik schafft Distanz
Ein weiterer Aspekt, der den Einsatz von Nachtsichtgeräten beim Jagen von Wildtieren betrifft, ist der Umgang mit dem Tötungsakt selbst. Aus einer ethischen Perspektive gilt es daran zu erinnern, dass das Töten eines schmerzempfindsamen Wesens nicht einfach leichtsinnig oder routinemäßig durchgeführt werden sollte, sondern reflektiert. Dabei steht aus einer ethischen Perspektive das Ziel im Vordergrund, Tiere möglichst schmerzfrei zu erlegen. Überlegungen zur Weidgerechtigkeit und bestimmte Aspekte des jagdlichen Brauchtums belegen, dass diese Anliegen im Jagdwesen durchaus eine Rolle spielen. Durch den verstärkten Einsatz von Technik besteht allerdings die Gefahr, dass das Wildtier vermehrt zum Objekt degradiert wird, das man fast schon wie in einer virtuellen Welt per Knopfdruck eliminiert. Das Erlegen von Wildtieren mithilfe von Wärmebildtechnik kann die Distanz zwischen der Person, die jagt, und dem Wildtier, das gejagt wird, erhöhen. Eine solche Distanz kann Einfluss auf die Haltungen der jagenden Person haben und eine Art Scheinwelt fördern, die das Töten von Tieren auf eine technische Leistung reduziert.
Spezialfall Wildschwein
In vielen Regionen Mitteleuropas ist der Einsatz von Nachtsichtgeräten bei der Bejagung von Wildschweinen eine legalisierte Praxis, weil Wildschweinbestände immer schwerer zu reduzieren sind. Als zusätzliches Argument wird hier auch sehr oft die Schweinepest angeführt. Allerdings stellt sich die Frage, wie erfolgreich diese Form der Bejagung ist, das heißt, ob dadurch tatsächlich eine Bestandsreduzierung erreicht wird. Da Wildschweine sehr anpassungsfähig sind, reagieren sie auch entsprechend schnell auf Änderungen in der Jagdpraxis und stellen die Jägerschaft vor neue Herausforderungen. Gerade die Reaktion des Wildschweins zeigt, wie sensibel Wildtiere auf die Bejagung in der Nacht reagieren. Beim Einsatz von Nachtsichtgeräten muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass tierethische Prinzipien nicht über Bord geworfen werden. Auch in der Nacht darf beispielsweise nicht einfach eine führende Bache erlegt werden.
Der Wert der Wildtiere
Das Erhöhen des Jagddrucks durch den zusätzlichen Einsatz von Technik wirft aus ethischer Perspektive eine grundsätzliche Frage auf, nämlich wie wir unsere Wildtiere bewerten. Auch wenn Wildtiere aus einer menschlichen Perspektive betrachtet Schäden in Land- und Forstwirtschaft anrichten, sind sie nicht einfach als Schädlinge einzustufen bzw. abzuwerten. Aus diesem Grund hat gerade die Jägerschaft die Aufgabe, auf diesen Wert immer wieder neu hinzuweisen.
Abusus non tollit usum
Dieses lateinische Diktum lässt sich auch auf die Verwendung von Nachtsichtgeräten anwenden. Der falsche Gebrauch einer bestimmten Sache verbietet noch nicht grundsätzlich dessen Gebrauch. Für Jagdzwecke muss der Einsatz von Wärmebildkameras gut begründet sein. Aus ethischer Perspektive gibt es, wie oben dargelegt, eine Reihe von Argumenten, die diesbezüglich nachdenklich machen und die Verwendung solcher Geräte in der konkreten Jagdpraxis einbremsen. Für Beobachtungs- und Monitoring-Zwecke leisten Wärmebildkameras aber wertvolle Dienste und eröffnen tatsächlich neue Welten.
Fazit
Im Jahr 2022 hat die Jägerschaft des Kantons Wallis in der Schweiz die Entscheidung getroffen, auf Nachtsichtgeräte bei der Bejagung von Wildtieren zu verzichten. Dabei wurden vor allem zwei Gründe genannt: Der Jagddruck auf das Wild steigt und die Konkurrenz innerhalb der Jägerschaft nimmt zu. Dieses Beispiel aus der Schweiz regt an, darüber nachzudenken, inwiefern Wärmebild- und Nachtsichtgeräte Fluch oder Segen für die Wildtiere und das Jagdwesen selbst sind. Die Entwicklungen im Bereich der Technik werden weitergehen und es werden wohl noch bessere und andere Geräte auf den Markt kommen. Die Jägerschaft ist angehalten, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie diesen Entwicklungen begegnen und was sie im Blick auf das Jagdwesen auch mitgestalten will. Das Wohl der Wildtiere und deren Ruhezeiten in der Nacht sollten dabei jedenfalls nicht außer Acht gelassen werden.