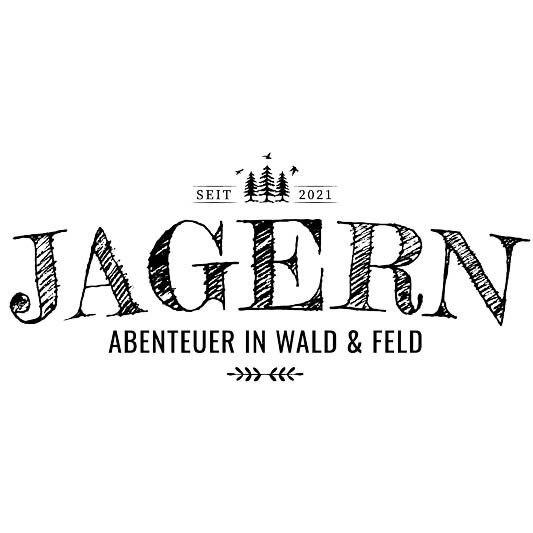Was ist Glyphosat?
Das erstmals 1950 synthetisierte und seit den 1970er-Jahren massiv in der Landwirtschaft eingesetzte Unkrautbekämpfungs- oder -vernichtungsmittel Glyphosat, chemisch ein Phosphonat, gilt als hochwirksames und preiswertes Totalherbizid. Es ist eine geruchlose, nicht flüchtige, wasserlösliche Substanz, die als Säure oder Salz hergestellt wird. Laut Herstellern und aktuellen Einschätzungen einiger Umwelt- bzw. Lebensmittelbehörden ist Glyphosat für den Menschen (Anwender, Konsumenten) bei sachgerechter Anwendung gesundheitlich weitgehend unbedenklich. Die Wirkung als Totalherbizid beschränkt sich auf Pflanzen, die direkt mit dem Wirkstoff besprüht werden. In Deutschland wurden in den letzten Jahren allein in der Landwirtschaft jährlich rund 5.000 Tonnen und im Hausgartenbereich etwa 90 Tonnen Glyphosat angewendet, in Österreich und der Schweiz werden jährlich rund 300 Tonnen des Wirkstoffs verkauft. Der Anteil von Glyphosat an allen verkauften Pflanzenschutzmitteln beträgt zumindest 30 Prozent.
Glyphosat ist etwa ein Wirkstoff des häufig eingesetzten Pflanzenschutzmittels Roundup®, es vernichtet „Unkräuter“ und Konkurrenzpflanzen auf Feldern mit Mais, Raps, Zuckerrübe und anderen Nutzpflanzen. Daneben findet es Einsatz auf Verkehrswegen, wie etwa Eisenbahntrassen, in öffentlichen Anlagen oder Heimgärten. Neben dem US-Konzern Monsanto wird das Mittel nach Auslaufen des Patents im Jahr 2000 nun von über 90 weiteren Herstellern vertrieben. Der größte Erzeuger ist China mit rund 40 Prozent der weltweiten Gesamtproduktion von weit über 700.000 Tonnen Glyphosat jährlich.
Im Jahr 2015 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ für den Menschen ein. Demgegenüber fanden einige europäische Behörden (EFSA, ECHA; auch deutsche wie etwa das BfR) sowie Behörden in den USA, Kanada, Australien, Japan und Neuseeland keine ausreichenden Hinweise auf ein Krebsrisiko. Ebenso wird kein erbgutschädigendes Risiko gesehen und Glyphosat ist auch kein Nervengift. Unabhängig davon existieren jedoch Bedenken, beispielsweise von Umweltbundesämtern, wegen der Vernichtung von Kräutern und Gräsern auf und um Ackerflächen sowie dem Verlust der Lebensgrundlage für Insekten und zahlreiche Vogelarten und damit einem Einfluss auf Ökosysteme. Obwohl das direkte Risiko für Bodenorganismen, Insekten und Vögel gering ist, hat jeder massive und großflächige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln immer indirekte Effekte auf das Ökosystem und die biologische Vielfalt, worauf später noch genauer eingegangen wird.
Wie wirkt es?
Glyphosat wirkt ausschließlich über grüne Pflanzenteile und nicht über die Wurzeln. In den Pflanzen wird durch die Ähnlichkeit von Glyphosat mit einem pflanzeneigenen Inhaltsstoff der Aufbau von für die Pflanzen essenziellen Aminosäuren blockiert, was zum Absterben der Pflanzen führt. Es ist das einzige Herbizid mit diesem Wirkmechanismus. Da Glyphosat nur auf grüne Pflanzenteile wirkt, kann es auf Felder zugleich mit der frischen Saat oder bis zu fünf Tage nach der Aussaat ausgebracht werden, um Unkräuter und Konkurrenzpflanzen zu bekämpfen. Weiters ausgebracht werden kann Glyphosat zwischen der Ernte der Winterfrucht und der Aussaat der Sommerfrucht oder, seltener und in einigen Ländern verboten, bis maximal sieben Tage vor der Ernte von Getreide, Raps und Leguminosen zur Abreifebeschleunigung und Unkrautbekämpfung. Nach unterschiedlichen Quellen werden 30 bis 40 Prozent des deutschen Ackerlandes mit Glyphosat behandelt, bei der pfluglosen Bodenbearbeitung wird es meist standardmäßig eingesetzt.
Auch im Wein- oder Obstbau wird es anstelle der arbeitsintensiven mechanischen Bodenbearbeitung zum Freihalten der Baumscheiben verwendet. Glyphosat wirkt nicht selektiv, das heißt, es sterben alle damit behandelten Pflanzen ab. Ausnahmen sind einige „Superunkräuter“, die mittlerweile resistent wurden, sowie gentechnisch veränderte Pflanzen, denen eine Glyphosat-Resistenz angezüchtet wurde und die damit auch noch nach dem Auskeimen behandelt werden können. Diese Pflanzen haben derzeit in Europa noch keine große Bedeutung.
Abbau und Nebeneffekte
Verglichen mit anderen Herbiziden hat Glyphosat eine recht kurze Halbwertszeit in der Umwelt (rund 14 Tage im Ackerboden), eine geringe Mobilität im Boden (starke Bindung an Bodenmineralien und damit geringe Auswaschung) und eine niedrige Toxizität gegenüber Tieren, was eigentlich wünschenswerte Eigenschaften für ein landwirtschaftlich verwendetes Pflanzenschutzmittel wären. Es wird vor allem von Mikroorganismen abgebaut.
Beim Betrachten der insgesamt ausgebrachten Mengen ist aber jedenfalls davon auszugehen, dass ökologische Folgen damit verbunden sind. Jedenfalls führt ein massiver Einsatz zu einer Verarmung der Pflanzenwelt mit entsprechenden Folgen für Insekten, Vögel und Säugetiere. Nicht gänzlich ausgeschlossen sind auch Wirkungen auf Mikroorganismen im Boden, Regenwürmer und aquatische Systeme. Zudem geht es beim Thema Glyphosat nicht nur im diesen Wirkstoff selbst, sondern auch um diverse Beistoffe in Glyphosat-Produkten (wie Tallowamin), von denen größere Toxizität und Nebenwirkungen zu erwarten sind.
Wegen der geringen Flüchtigkeit von Glyphosat ist eine Verdampfung nicht zu befürchten, sehr wohl aber eine Verdriftung beim Ausbringen, besonders dann, wenn es sogar mit Flugzeugen ausgebracht wird. Gegen diese Verdriftung gibt es beispielsweise in der Schweiz Vorschriften, dass Glyphosat 3 Meter um Feldrandhecken, 3 Meter von Waldrändern, 3 bis 6 Meter von Oberflächengewässern, auf Terrassen und Dächern, an Wegen und Straßen sowie an Böschungen und Grünstreifen nicht angewendet werden darf.
Verzicht statt Verbot?
Im November 2017 wurde Glyphosat nach heftigen Diskussionen für weitere fünf – statt ursprünglich geplant für zehn – Jahre in der EU zugelassen. Die EU-Kommission hat im November 2023 die Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für weitere zehn Jahre genehmigt. In Frankreich gilt seit 2015 ein Verkaufsverbot in Gartenzentren. Das Thema Glyphosat wurde in einigen Ländern zum Wahlkampfthema. Ohne Ersatzmittel muss man mit derartigen Verboten/Verzichtserklärungen aufpassen, da ein Ausstieg aus der derzeit geübten landwirtschaftlichen Praxis bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen nur schwer möglich scheint. Auch Konsumenten müssten sich bewusst sein, dass es inkonsequent wäre und ist, das Verbot einer Chemikalie zu fordern und dann dennoch billigste Lebensmittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft zu kaufen.
Ein Ausstieg aus einem Masseneinsatz von Agrochemikalien wäre nur bei einer vollkommenen Umstellung der derzeitigen intensiven Bewirtschaftungsweise hin zu alternativen, meist teureren und arbeitsaufwändigeren Bewirtschaftungsformen in kleineren Einheiten möglich. Sonst wäre mit Ertragseinbußen und einer weiteren Ausweitung der Anbaugebiete bzw. Importe zu rechnen. Dies würde sich aber jedenfalls im Preis der Agrarprodukte niederschlagen.
Zu diskutieren sind zudem die Sinnhaftigkeit und der ökologische Wert sowie die ethische Dimension der Biogaserzeugung aus Mais und Getreide. Allein in Deutschland ist die Maisanbaufläche vom Jahr 2000 bis 2014 um eine Million Hektar auf insgesamt 2,5 Millionen gestiegen! Dass die Problematik nicht neu ist, beweist bereits ein Zitat von Wilhelm Wetekamp, einem Pionier des Naturschutzes in Preußen, aus dem Jahr 1898 (!): „Der zivilisierte Teil der Menschheit wird bald mit Schaudern der Monotonie gewahr werden, welche sie nicht nur bedroht, sondern bei welcher sie teilweise schon jetzt angelangt ist. Roggen, Weizen, Gerste, Hafer – der Abwechslung zuliebe auch umgekehrt Hafer, Gerste, Weizen, Roggen – sehen Sie, das wäre die Flora der Zukunft.“
Tägliche Lebensraumverluste
Die in Mitteleuropa gefährdetsten Lebensraumtypen sind Wiesen, Weiden und Äcker, also agrarisch genutztes Land. Allein in Österreich sind in den letzten 50 Jahren beinahe 400.000 Hektar Grünland aufgegeben oder aufgeforstet worden, weitere fast 200.000 Hektar wurden verbaut oder anderweitig versiegelt. Durch diese Veränderung der Lebensräume werden nicht nur Räume für viele Arten enger, auch die Anzahl vieler Pflanzen- und Tierarten verkleinert sich.
Auch die Grünlandbewirtschaftung, in der zumindest Punktbehandlungen mit Glyphosat erfolgen (z. B. Ampferbekämpfung), hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten stark intensiviert (häufigere Schnittnutzungen, Kraftfuttereinsatz, massive Gülleausbringung).
Wenn vor 40 Jahren auf einer Wiese noch zumindest 20 bis 30 Pflanzenarten vorgekommen sind, so sind es heute auf denselben Flächen oft nur mehr drei bis vier Futterpflanzen mit allen Konsequenzen für die auf solche Arten angewiesenen Tiere. Die Folgen sind derzeit erst ansatzweise erfassbar. Blumenwiesen zu verlangen und dennoch 1 Liter Milch um 70 bis 80 Cent kaufen zu wollen, ist ein widersprüchliches Verhalten der Konsumenten.
Durch die Intensivierung der Feldbewirtschaftung mit Zusammenlegung von Flächen (Flurbereinigung, Kommasierung) kam es allein in Österreich zum Verlust von über 250.000 Kilometern (6,4-fache Äquatorlänge!) an Wege- und Feldrainen. Diese Standorte waren aber zugleich Lebensraum vieler, teilweise schon gefährdeter Pflanzenarten wie Kornblume, Feld- und Rittersporn, Mohnblume, Horn- und Hufeisenklee, Taubenskabiose usw. Diese Pflanzengesellschaften sind wiederum Grundbedingung für eine tierische Artenvielfalt. So können einer Pflanzenart mindestens zehn verschiedene Tierarten zugeordnet werden, die Quecke dient sogar bis zu 80 Tierarten als Nahrungsquelle!
Selbst im kleinen Hausgarten wäre es mög-lich, nicht die gesamte Fläche als Kurzrasen zu halten, sondern Blumenwiesenstreifen oder Randstreifen zu fördern. Langjährig überdüngte und 20-mal pro Jahr – mittlerweile mit Rasenroboter noch häufiger – gemähte Rasenflächen können nicht von heute auf morgen in blühende Wiesen zurückgeführt werden, dieser Prozess braucht seine Zeit. In der Landwirtschaft trägt der Erhalt von extensiv bewirtschafte-ten Flächen einen unschätzbaren Beitrag zur Artenvielfalt und Biodiversität bei.
Parallelbeispiel „Schmetterlingssterben“
Die Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera) umfasst weltweit rund 150.000 Arten und ist die zweitgrößte Insektengruppe, mehr als 4.000 Arten sind bei uns in Österreich beheimatet. Schmetterlinge gehören zu den Insekten mit sogenannter „vollkommener Entwicklung“, d. h. zwischen Larvenstadium (= Raupe) und fertigem Insekt ist ein Puppenstadium eingeschaltet. Weibchen können bis über 1.000 Eier legen. Raupen haben beißende Mundwerkzeuge und ernähren sich je nach Art von einem sehr engen Spektrum an Nahrungspflanzen – manche Arten sind überhaupt auf nur eine Nahrungspflanze angewiesen. Fehlen nun diese bestimmten Nahrungspflanzen, stirbt die betreffende Schmetterlingsart aus. Schmetterlinge sind also wichtige Bioindikatoren, um ökologisch wertvolle Flächen zu erkennen, auf denen auch viele andere Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Sie reagieren höchst sensibel auf Änderungen im Lebensraum. Und wenn es den Schmetterlingen schlecht geht, haben auch viele andere Insekten, Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger sowie Niederwild ein Problem.
Als Raupen dienen Schmetterlinge auch als wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Schmetterlingsraupen haben meist nur eine Futterpflanze und sind deshalb von deren Vorkommen abhängig. Kaum ein Insekt wird so bewundert wie die Schmetterlinge, was vor allem an ihrer einzigartigen Farbenpracht liegt.
Der Bestand an Fluginsekten, vor allem jener der Schmetterlinge, ist laut Studien in den vergangenen drei Jahrzehnten um 75 Prozent zurückgegangen. Verantwortlich für diese Entwicklung ist der Mensch. Einige Ursachen des Rückgangs sind die Intensivierung der Grünland- und Ackerbewirtschaftung, Verlust von Trockenrasenstandorten, Feuchtwiesen, Mooren, Insektizide, Futterpflanzenverluste sowie Luftschadstoffe und der Autoverkehr. Sehr problematisch ist auch, dass es nahezu keine pflanzenartenreichen Naturgärten mehr gibt, sondern mehr und mehr ein Mähroboter den Garten „pflegt“. Derzeit noch intakte Lebensräume liegen immer weiter voneinander entfernt. Dadurch wird einerseits ein Genaustausch zwischen den Populationen schwieriger und andererseits können einzelne Gebiete beim Zusammenbruch einer Population kaum mehr aus der Umgebung wiederbesiedelt werden, weil die Distanz zum nächsten geeigneten Lebensraum zu groß wird.
Allein in der Steiermark sind schon 81 Arten von Großschmetterlingen ausgestorben. Tagfalter mit rund 200 Arten sind die am meisten gefährdete Insektengruppe. Je spezialisierter eine Art ist, umso anfälliger ist sie. Vor allem Arten, die auf Magerwiesen, in Mooren oder Heidelandschaften leben, sind selten geworden. In Bayern sind bei manchen Arten die Bestände bis zu 90 Prozent rückläufig. Im 21. Jahrhundert wären außerdem 11 Prozent der Arten, die zuvor in Bayern gelebt haben, nicht mehr zu finden, das sind 364 von ehemals 3.300 Arten. 1.000 weitere stehen als „gefährdet“ auf der Roten Liste. In Österreich ist die Hälfte der Tagfalter mittlerweile vom Aussterben bedroht, denn ihr Lebensraum schrumpft. Bedingt durch den Klimawandel sind einige Schmetterlingsarten in den letzten drei bis vier Jahrzehnten in 300 bis 400 Meter höher gelegene Gebiete gewandert, wo allerdings die Tag-Nacht-Temperaturschwankungen extremer sind. Schmetterlinge sind neben Bienen und Hummeln wichtige Bestäuber für Blütenpflanzen, denn es gibt viele Blüten, die nur von Schmetterlingen bestäubt werden können, weil sie so lange Röhrenblüten haben, in die nur der Schmetterlingsrüssel hineinpasst. Sterben Schmetterlinge aus, verschwinden auch diese Pflanzen. Schmetterlingsraupen sind zudem eine wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere wie beispielsweise Singvögel.
Vergiftungsverdacht
Die Diagnose „Vergiftung“ kann gesichert nur gestellt werden, wenn das entsprechende Gift nachgewiesen wird. Bei der Vielfalt der Vergiftungsursachen und -möglichkeiten – z. B. Rodentizide (Mäuse-/Rattengift), Pflanzenschutzmittel, Pestizide, Umweltgifte, pflanzliche und tierische Gifte) – und wegen der selten eindeutigen Symptomatik ist jedoch die Diagnosestellung schwierig und jeder vermeintlich noch so unwichtige Hinweis für eine Diagnose wertvoll. Gifte gelangen beim Fressen, über die Haut, durch Abschlecken des Fells oder Federkleids, beim Einatmen oder durch den Biss eines giftigen Tieres in den Körper. Da es labordiagnostisch keinen Universaltest auf Giftstoffe gibt und die Untersuchungen meist teuer sind, kann im Verdachtsfall nur nach bestimmten Stoffen gesucht werden, wobei dazu ein Verdacht hinsichtlich einzelner Stoffe oder Stoffgruppen unerlässlich ist.
Resümee
Ohne grundlegende Änderung unserer Lebenseinstellung werden wir aktuelle und zukünftige Probleme wie Energiefragen, Klimawandel oder Wasserqualität nicht mehr beherrschen oder bewältigen können. In der Energiefrage setzen wir zunehmend auf erneuerbare Energiequellen – das ist prinzipiell gut. Nur wenige Menschen und Institutionen machen sich aber auch Gedanken zum Einsparen von Energie. Es beginnt im Kleinen, wenn wir an die zig Millionen Botschaften in sozialen Medien rund um die Feiertage denken, und geht bis zu überheizten Wohnungen oder Kurzfahrten mit dem Auto. Auch wenn es sich um ein E-Auto handelt, muss der Strom zuerst einmal erzeugt werden. Wenn es Ökostrom ist, so verbraucht auch seine Gewinnung Ressourcen.
Kommen wir zum Energiemais zurück: Auch dieser muss gesät, mit Herbiziden (wie Glyphosat) behandelt, geerntet und in Biogasanlagen transportiert werden, was schon einiges auch an fossiler Energie kostet. Nach starkem Rückgang des Ökostromzuschlags (aus Steuermitteln) in Österreich schlitterten zahlreiche Betreiber von Biogasanlagen in Konkurs oder sperrten die Anlagen, nicht zuletzt auch wegen steigender Pacht- und Getreidepreise.
Ähnlich ergeht es Betreibern von Kleinwasserkraftanlagen, die nicht immer so ökologisch vorteilhaft sind, wenn man die geringen Restwassermengen in den Bächen mit ihren Folgen für das Wasserökosystem im Winter genauer betrachtet. Erschreckend ist auch ein österreichisches Beispiel zum täglichen Brot. In Wien (ca. 2 Millionen Einwohner) wird täglich so viel Brot und Gebäck entsorgt, wie in Graz (gut 300.000 Einwohner) täglich verzehrt wird. Wir sind es mittlerweile gewohnt und fordern richtiggehend ein, dass noch knapp vor Geschäftsschluss sämtliche Brotsorten oder diverses Gebäck erhältlich sind – der Rest, und damit Unmengen an Brotgetreide (die mit unnötig eingesetztem Glyphosat behandelt wurden), werden entsorgt!
Zurück zum Glyphosat: Ohne einerseits Energie zu sparen und andererseits als Konsument bereit zu sein, für landwirtschaftliche Produkte etwas tiefer in die Tasche zu greifen, wird der Mensch den Lebensraum (noch dazu vor dem Hintergrund des Klimawandels) in den nächsten wenigen Jahrzehnten rasant und markant ändern. Der Austausch von Glyphosat gegen ein anderes (Total-)Herbizid reicht also nicht aus, um eine ökologische Kehrtwende zu schaffen.
Wir Jäger sind hautnah am Geschehen und erkennen die Symptome, etwa den Rückgang von Hasen, Rebhühnern, Singvögeln und Insekten, vielleicht nur ein bisschen früher als der Großteil unserer Mitbewohner. Es ist gesellschaftlich recht leicht und politisch opportun, beispielswiese ein Glyphosat-Verbot oder einen Verzicht zu fordern. Nur muss man dann auch einen Schritt weiterdenken, denn nur der Austausch von Chemikalien allein wird zu wenig sein.