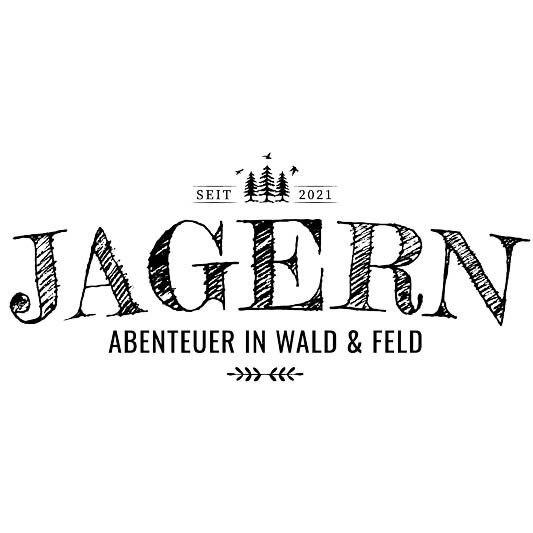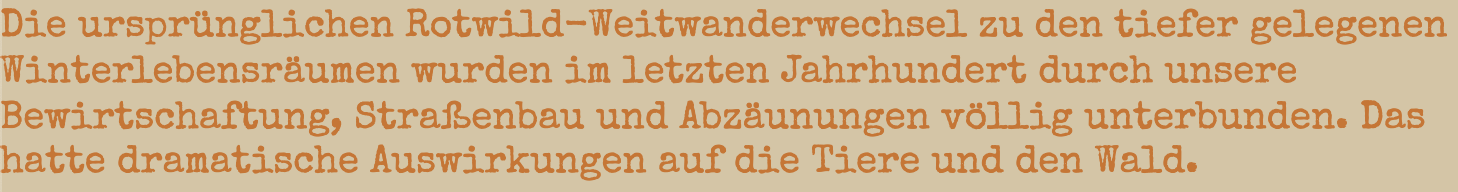
Die entlegenen Wälder im nördlichen Hochschwabgebiet sind heute zumeist im Besitz der Bundesforste und der Stadt Wien, die auf eine naturnahe Bewirtschaftung setzen und deshalb möglichst wenige Fütterungen für das Rotwild betreiben wollen. Dabei sprach schon Erzherzog Johann, der steirische Prinz, um 1830 vom Wild, „das über den Winter zu bringen sei“. So gab es hier in der Gegend lange flächendeckend Rotwildfütterungen, wovon einige schon in der Kaiserzeit betrieben wurden. Leider spricht alles dafür, dass hier in den nächsten Jahren auch noch die wenigen vorhandenen Rotwildfütterungen verschwunden sein werden, obwohl es meiner Meinung nach keine andere Möglichkeit mehr gibt, jagdbare gesunde Rotwildbestände in dieser Bergregion zu erhalten.
Da die Jagd noch vor einigen Jahrzehnten Großteils dem Adel vorbehalten war, waren diese idealen Lebensräume äußerst großflächig und vor allem mit Berufsjägern sowie zugeteilten Jungjägern besetzt. Außer während der Kriegsjahre waren die Gams-, Rot-, aber auch Rehwildbestände hier für heutige Begriffe unvorstellbar hoch. Rotwild wurde so bejagt, dass es ungestört den Sommer und Herbst auf den beweideten Hochalmen verbringen konnte, und im Winter wurde es in den Tallagen gefüttert, was ja auch mit Fachpersonal über viele Jahrzehnte hervorragend funktionierte. Viele der Mischwälder wurden zum Betreiben der Hochöfen nach und nach abgeholzt und es wurde nur mehr großflächig mit gewinnbringenden Fichtenmonokulturen aufgeforstet. Laubholz war nicht mehr erwünscht und wurde noch bis Ende der 1960er-Jahre geringelt oder mit Diesel vergiftet. Zu dieser Zeit gab es nicht nur hohe Wildbestände, sondern auf den Almen und in den Tälern weideten auch Unmengen an Vieh.

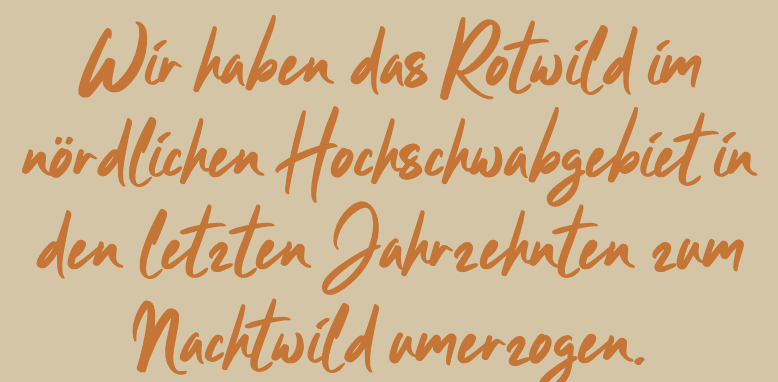

In den Siebzigerjahren begann man wieder, die Mischwälder zu schätzen und machte für die Entmischung das Weidevieh, aber vor allem das Wild – insbesondere das Rotwild – verantwortlich. Von forstlicher Seite wurde eine aggressive Wildfeindlichkeit immer spürbarer und die Abschüsse wurden rücksichtslos vorangetrieben, denn es war nach Meinung der Forstwirtschaft nicht möglich, den Wald klimafit zu machen und dabei die hohe Wilddichte zu erhalten. Um die hohe Anzahl an Abschüssen zu erfüllen, wurden so schon in den Achtzigerjahren Treibjagden, oft auch bei hoher Schneelage, in den Wintereinständen durchgeführt, worauf sich das Wild tagelang nicht zu den Futterplätzen wagte und in den Monofichtenkulturen verheerende Schälschäden anrichtete. So wurde das Rotwild zu Nachtwild und regelrecht zum Schälen erzogen. Durch die radikale Reduzierung der Tiere, aber auch durch immer strenger werdende Compliance-Vorgaben für Konzerne und Politik vertrieb man dann auch noch die Großpächter samt Berufsjäger und teilte diese unbedingt notwendigen großflächigen Lebensräume für Rotwild auch in den Hochlagen klein auf. Vergeben wurden diese nun leistbaren Reviere an viel zu viele neuzeitliche Jäger, denen die Möglichkeit geboten wurde, auf Begegnung zu jagen – das heißt, alles darf geschossen werden, was ihnen begegnet. Bestätigung findet man bei der alljährigen Trophäenschau in Gußwerk bei Mariazell.
Als weitere Maßnahme zum Wiederaufbau der Mischwälder errichtete man unzählige zwei Meter hohe Zäune, die wiederum den Wildschäden zugerechnet wurden. Nach etwa 30 Jahren wurden diese wieder abgetragen oder sie verfielen. Heute erkennt man keinen Unterschied mehr, was inner- oder außerhalb dieser Flächen war. Das Laubholz hat sich derweil ohne forstliche Hilfe von selbst erholt und das bei einem noch recht hohen Wildbestand der Achtziger- bzw. Neunzigerjahre. Es braucht eben seine Zeit.
Vor etwa 40 Jahren hat man dann hier in den Staatswäldern begonnen, entlang des Salzatals auf ungefähr 40.000 ha 14 Wintergatter zu bauen. Wirklich funktioniert haben aber nur die in den Privatwäldern und anfangs einzelne der Gemeinde Wien. Wobei Wintergatter, wenn das Revier dafür geeignet ist, eine gute Lösung wären, was ja auch einige private Großgrundbesitzer, wie zum Beispiel die Familien Lichtenstein oder Mayr-Melnhof in der Steiermark beweisen, die diese seit vielen Jahrzehnten vorbildlich betreiben. Die Gebirgswälder sind durch diese Gatter während den Wintermonaten in kurzer Zeit bei optimaler Betreuung rotwildleer. Das hat denselben Effekt wie zu der Zeit, als das Rotwild in großen Rudeln noch zu den niedergelegenen Äsungsplätzen ziehen konnte. Das Wild gewöhnt sich bei professioneller Betreuung und einladender Bauweise der Zäune in erstaunlich kurzer Zeit an diese Überwinterungsreservate und fühlt sich darin auch recht sicher vor dem ständig steigenden Tourismus. Von den Bundesforsten hört man allerdings immer wieder, sie wollen „keinen Streichelzoo“ bei den Fütterungen und „das Wild muss scheu bleiben“.
Bei jeder gut betreuten Fütterung sollte das Wild die Möglichkeit haben, vor allem auch tagsüber den Futterplatz aufzusuchen. Daher ist es eine logische Schlussfolgerung, dass es seinem Betreuer, der jeden Tag zur selben Zeit erscheint, völlig vertraut wird. Ich schätzte Jagdherren und Jäger immer sehr, die mit Begeisterung vertrautes Wild an meinen Futterplätzen beobachteten und es nicht nur als Jagdobjekt betrachteten. Durch diese Vertrautheit wird auch der Wartesaaleffekt in den umliegenden dichten Fichtenkulturen verhindert und die Unart des Schälens kommt erst gar nicht auf.



Ab 2010 begann man, die errichteten Wintergatter wieder abzubauen, da sich der erwartete Erfolg durch unprofessionelle Betreuung nicht einstellte. Es dauert eben eine Rotwildgeneration, um mit viel Erfahrung und Gefühl ein anerzogenes Hunger- und Stressschälen wieder zu korrigieren. Die letzten Gatter, die es jetzt hier noch gibt, werden schlecht betreut und daher vom Rotwild nur im äußersten Notfall bei extremer Schneelage aufgesucht.
Regelmäßig werden in der Umgebung der Futtereinstände zu Beginn der Notzeit großflächig Treibjagden mit hohem Personenaufwand und frei hetzenden Hunden abgehalten. Im Laufe der Jahre wurde dazu immer minderwertigeres Futter in Form von Siloballen von ungepflegten Wiesen vorgelegt. Dazu kommt noch der ständig überhöhte Jagddruck in der gesamten Schusszeit von zu vielen Jägern. Voraussetzung für eine erfolgreiche Fütterung wäre es aber, dass das angebotene Futter besser sein sollte als das, was die Bergregion während der Notzeit hergibt. Fehlt dies, versucht das Rotwild auf witterungsbegünstigten Plätzen, wo es auch jagdlich unerreichbar ist, zu überwintern. In den letzten Jahren war es hier keine Seltenheit, dass Notzeitabschüsse freigegeben wurden und Rotwild, das aus Angst die Fütterung verweigerte, bei hohem Schnee aus den Kulturen ausgetrieben wurde. Durch diese Art der Bewirtschaftung wurde das verbliebene Rotwild dermaßen scheu, dass die wenigen Stücke, die schlecht gefüttert wurden oder aus Angst diese Plätze nicht mehr aufsuchten, auch erhebliche Schäden anrichteten. Was wiederum bedeutet, „dass Rotwild zur Gänze verschwinden muss, um völlig schadfrei zu sein“.
Ein weiterer grober Eingriff in den Lebensraum des Rotwilds ist das unglaubliche Forststraßennetz, das hier in den letzten Jahrzehnten entstanden ist und es kommen jedes Jahr weitere Straßen dazu. Jeder Berghang ist mehrfach durchschnitten und auch in den entlegensten Gräben findet man wetterfeste Hochstände, die bequem und in kurzer Zeit mit jedem PKW zu erreichen sind. Dadurch sind diese aufgeschlossenen Wälder nicht nur um die Hochstände, sondern auch entlang der Straßen auf Schussentfernung, die inzwischen schon die 500-Meter-Grenze erreicht, bei Tageslicht völlig wildleer. So wird das von Natur aus tagaktive Rotwild veranlasst, nur mehr nachts aus den immer weniger werdenden sicheren Beständen auszutreten. Rotwild lebt hier ständig im Krieg und von einem wirklichen Lebensraum kann man eigentlich nicht mehr sprechen. Zuerst hatte man ihm die Wintereinstände genommen und jetzt auch noch die Sommereinstände.
Schade, dass man in den Staatswäldern nicht die Erfahrungen über Rotwildbewirtschaftung nützt, die ja auch in zahlreichen Büchern festgehalten sind, oder noch immer in so manchen Privatwälder tadellos funktionieren. Gerade die beweideten Hochalmen, wo es niemals Wildschäden gab, sollten großflächig mit Berufsjägern betreut werden, die ihr Revier über Jahre hindurch bestens kennen und einen geregelten Jahresablauf schaffen. Auch Hegeabschüsse müssen und können nur von Berufsjägern erfüllt werden, und zwar so, dass es möglichst wenig Beunruhigung gibt. Gäste sollten in solchen Kerngebieten geführt werden und Abschussgehilfen sollte man genau überdenken.
Wir haben das Rotwild im nördlichen Hochschwabgebiet in den letzten Jahrzehnten zum Nachtwild umerzogen und das nur mit unüberlegter, aggressiver Bejagung. Dabei wäre Rotwild eigentlich recht leicht zu lenken, vorausgesetzt, dass man ihm über Jahrzehnte hindurch den Freiraum lässt, den es selber vorgibt. Die Kunst ist, seine Sprache deuten zu wissen und vor allem auch, das zu wollen. Das geht nur mit gutem idealistischen Berufspersonal, das sich dazu berufen fühlt und das man auch immer noch finden würde. Es geht ja hier um die Lebensraumerhaltung unseres Rotwildes und nicht um eine in Mode gekommene Freizeitgestaltung. Jeder, der sich mit Rotwild intensiv befasst hat, wird mir recht geben, dass eine Bejagung, die sich kaum spürbar auf die Rotwildbestände auswirkt, durchaus möglich ist. Nur das verhindert Schäden und schafft für dieses edle Wild einen gebührenden Lebensraum. Ganz nebenbei kann hier hochwertiges Fleisch von freilebenden Tieren geerntet werden. Das erspart Tierleid auf engstem Raum, was jeden Tierschützer hoch erfreuen müsste und Wildfleischimporte aus anderen Kontinenten würden damit im Sinne der Nachhaltigkeit auch verhindert.


Ich war in der dritten Generation am nördlichen Hochschwab über dreißig Jahre lang Berufsjäger und kenne daher aus vielen zurückliegenden Jahrzehnten die Wildbestände, aber auch die Schlägerungen und das Wiederemporwachsen dieser Wälder. Am gesündesten sind die wenigen Wälder, wo es noch keine Forstbewirtschaftung gab: hier war immer Rot-, Reh- und Gamswild. Wirklich waldverwüstende Wildschäden hat es hier nur in der Form von Schälungen gegeben, und zwar in einem erschreckend katastrophalen Ausmaß. Wie kann man nur dieses edle Wild so mies behandeln, dass es dazu veranlasst wird, solche Schäden zu verursachen? Ich bin in den letzten Jahren einen Großteil der Einstände von aufgelassenen Fütterungen, aber auch Fichtenkulturen an den Äsungsflächen, die von Hochständen umzingelt sind, im weitläufigen Hochschwabgebiet abgegangen und war erschüttert über derartige waldverwüstende Schäden. Jeder, der die tatsächlichen Vorgeschichten Witterungsumschwünge nützen, Situationen richtig einschätzen, niemals Stücke schießen, die als Erstes ausziehen, ein sofortiges Verenden mit lautlosem Schuss ohne Kampf und niemals Aufregung schaffen: so hatte ich mir im Laufe der Jahre eine Rotwildbejagung angeeignet, die das Wild selbst vorgab und es in keiner Weise beunruhigt.
Die Abschusserfüllung vom tatsächlichen Wildbestand ist unbedingt erforderlich, jedoch darf das Wild dadurch nicht gehindert werden, auch tagsüber völlig ruhig den Futterplatz aufzusuchen. Das ist durchaus möglich, aber nur in großflächigen Revieren mit Berufsjägern, die ihr Wild und die Gegebenheiten bestens kennen und es ist in keiner Weise mit einer Hobbybejagung zu vergleichen. So durfte ich unter den Jagdherren Mayr-Melnhof und August von Finck diesem edlen Wild einen artgerechten Lebensraum bieten, der sich auch in den Wäldern widerspiegelt. Leider wurde der Reduzierungsdruck seitens der Österreichischen Bundesforste und der Gemeinde Wien immer unerträglicher und so wurden auch diese beiden Reviere, die sich inmitten eines ehemaligen großflächigen Rotwildkerngebietes befanden, wo einst auch der Jagdschutzverein gegründet worden war, aufgelöst und der gesamte Wildbestand radikal heruntergefahren. Auf Brunftplätzen, wo früher tagelang durchgehender Brunftbetrieb herrschte, ist heute kein Ton mehr zu hören. Nie hat man in diesen Staatswäldern auch nur ansatzweise versucht, den schon stark reduzierten Bestand – vielleicht den der Neunzigerjahre – zu erhalten. Egal ob Rot-, Reh- oder Gamswild, es wurde immer nur gnadenlos weiter reduziert, obwohl sich nachweislich der Mischwald, der früher völlig unerwünscht war, bei einem noch recht hohen Wildbestand ohne Hilfe wieder erholen konnte.
Heute findet man in den Wäldern der Gemeinde Wien groß-flächig niedergeschnittene gesunde Fichten, die man einfach liegen lässt, obwohl der Borkenkäfer in einem noch nie dagewesenen Ausmaß wütet. Unverständlicherweise werden auch Fichtenkulturen von Hand geschält, um sie zum Absterben zu bringen, ähnlich wie man früher das Laubholz behandelt hat. Das nur noch wenig vorhandene extrem scheue Wild scheint für die jetzige Jägergeneration zur Bejagung weitaus interessanter zu sein, als Lebensräume zu erhalten, es zu hegen und mit Freude zu beobachten. So sind im nördlichen Hochschwabgebiet diese idealen Lebensräume, wo einst die Jagd überaus hochgeschätzt wurde, nahezu wildleer. Leider ist keine Besserung in Sicht.
Text: Martin Prumetz
Fotos: Martin Prumetz, Adobe Stock