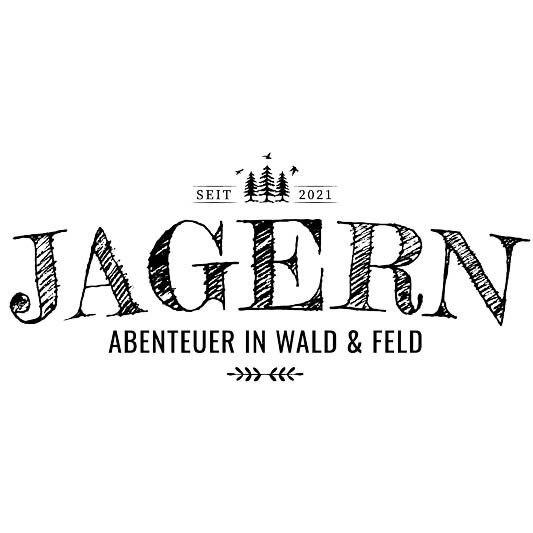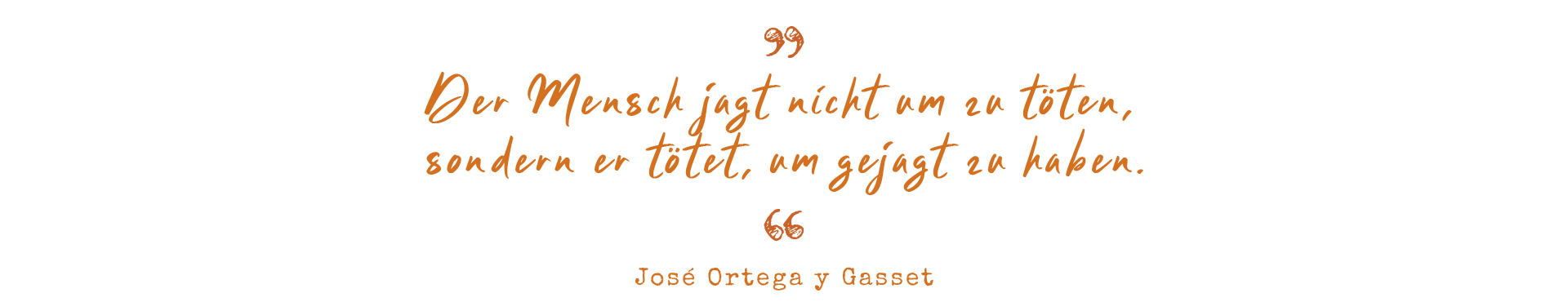Die Gesellschaft scheint gespalten, wenn es um das Thema Tierethik und -rechte geht. Auf der einen Seite stehen Bewegungen, die auf rein pflanzliche Ernährung setzen, Tierleid unter allen Umständen vermeiden wollen und in manchen Ländern allen Wirbeltieren Gefühle und Emotionen per Gesetz zuschreiben, auf der anderen Seite wirft man abertausende männliche Küken lebend in einen Schredder, werden Mäuse und Ratten zum Schutz von Lebensmitteln reihenweise vergiftet und lockt das 3€-Schnitzel im XXL-Restaurant. Wie wir uns als Jäger in dieser aufgeheizten Debatte positionieren können und dass die Freude an der Jagd nichts ist, wofür man eine Rechtfertigung braucht, das haben wir mit Erich Hofer aus Bad Großpertholz besprochen.
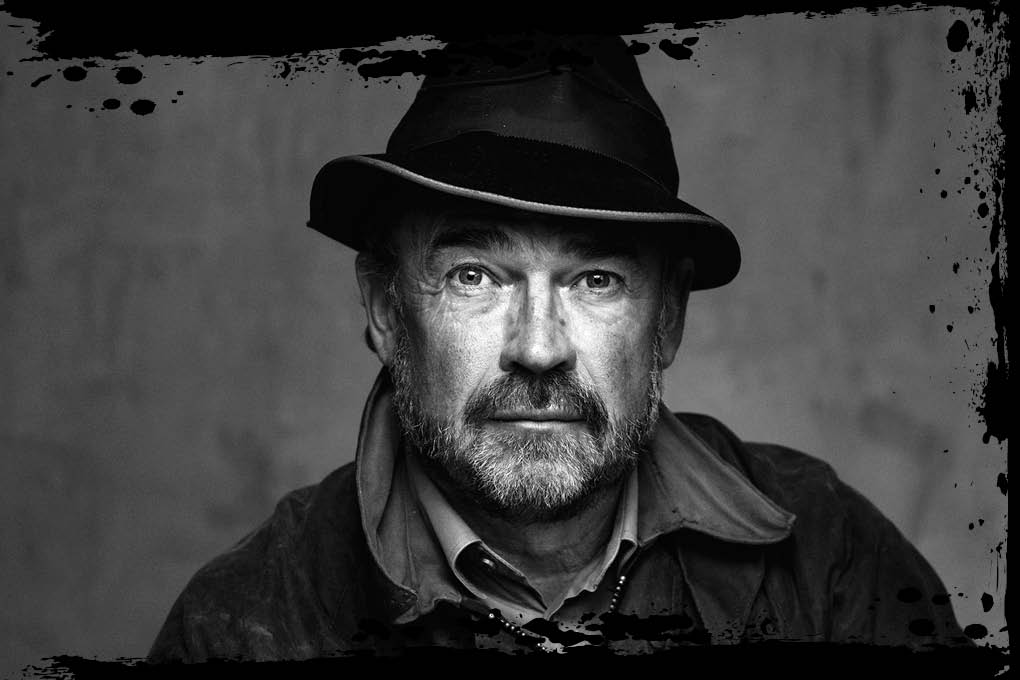
Wie kam es, dass du begonnen hast, dich mit Fragen zur Ethik in der Jagd auseinanderzusetzen?
Mein Bruder und ich sind seit fast 40 Jahren Jagdpächter in NÖ. Ich selbst jage seit rund 50 Jahren und habe auch den Lehrgang zum akademischen Jagdwirt an der BOKU gemacht. Seit 1980 bin ich auch in der Jungjägerausbildung tätig. Wie die meisten Menschen macht man im Zuge seines Lebens Entwicklungen durch und hinterfragt sein Handeln, insbesondere bei so einem sensiblen Thema, das letztendlich mit dem Tod von Mitgeschöpfen zu tun hat. Da kommt man unweigerlich mit den Themen wie Tierethik und Tierrechte in Kontakt. Mittlerweile gestalte ich gemeinsam mit Markus Moling das Modul Jagdethik im Rahmen des Lehrganges zum akademischen Jagdwirt.
Was braucht es deiner Meinung nach für eine ethische Jagd?
Ich will es nicht vereinfachen, aber um eine sinnvolle und in der Öffentlichkeit einigermaßen anerkannte Jagd zu betreiben, bedarf es in erster Linie eines gesunden Menschenverstandes, ein bisschen Empathie und Einfühlungsvermögen und natürlich auch ein bisschen Hirn. Das könnten die meisten auch erfüllen, aber manche wollen es aus verschiedenen Gründen nicht.
Woran liegt das?
Das hängt auch mit der Sozialisation in der Jagd zusammen. Ich bin selbst auch noch in den 70er-Jahren „klassisch“ jagdlich sozialisiert worden. Da waren Dinge in der Jagdpraxis durchaus alltäglich und anerkannt, die auch kaum hinterfragt wurden. Ich bekenne mich
durchaus dazu, dass ich viele Dinge in meiner jagdlichen Laufbahn auch selbst getan habe, die ich nun seit vielen Jahren nicht mehr mache und auch offen kritisiere.
Gab es bei diesen Dingen Momente, in denen du dir gedacht hast „eigentlich ist das nicht in Ordnung“?
Ja, diese Erweckungserlebnisse hat man eigentlich recht bald, wenn man halbwegs vernünftig denkt.
Wie haben sich diese angefühlt?
Der erste negative Eindruck war eine Reizlosigkeit. Die jagdliche Spannung hat vollkommen gefehlt. Und man fragt sich sehr schnell, macht das noch Sinn?
Macht der Grundsatz: „Was ich jage, esse ich auch“ einen ethischen Unterschied?
Wir jagen alle, weil wir Freude an der Jagd haben. Es gibt niemanden, der sich denkt, um Gottes willen, ich muss jetzt das Reh schießen, um den Wald zu retten, außer vielleicht in einem Forstbetrieb, wenn einem der Wald selber gehört. Und keiner der vielen tausend Jagdpächter in Österreich jagt, um etwa das Ökosystem zu erhalten, oder ausschließlich zur Fleischproduktion, sondern weil er Freude an der Jagd hat. Aber die Verwertung des Wildbrets muss eine wichtige Säule in der Nachhaltigkeitsbetrachtung der Jagd sein. Ich selbst habe auch Freude an einer starken und reifen Trophäe, aber dies kann nicht mehr im Mittelpunkt unseres jagdlichen Handelns stehen.
Übrigens, wenn jeder Jagdkartenbesitzer in Österreich zwei oder drei Rehe selbst verzehrt, gibt es am österreichischen Wildbretmarkt kein verfügbares Rehwildbret mehr.
Was kennzeichnet für dich diese Freude an der Jagd?
Wichtig ist mir zu unterscheiden, was auch schon der spanische Philosoph José Ortega y Gasset festgestellt hat: „Der Mensch jagt nicht um zu töten, sondern er tötet, um gejagt zu haben.“ Wir haben keine Freude am Tötungsakt, wir haben Freude an der Jagd. Das wird in der Öffentlichkeit leider häufig anders ausgelegt und viele, die sich noch nie damit beschäftigt haben, glauben, Jäger haben Lust am Töten. Dass der Tötungsakt unabdingbar ist bei der Jagd, kann man nicht bestreiten, aber „Catch und Release“ wie bei den Anglern, das geht eben nicht. Und wenn wir schon dabei sind: das könnte man überhaupt viel kritischer sehen! Ein zweistündiger Drill ist für den Fischer ein Megaerlebnis,
für den Fisch ist es ein zweistündiger Überlebenskampf und steht ganz im Gegensatz dazu, was eine weidgerechte Jagd für das Wild bedeutet! Aber Fische sind nicht lieb, sie haben kein Kindchenschema und sie schreien nicht. Daher haben sie auch die schwächere Lobby in den Gegnern. Mit einem getötetem „Bamby“ kann man in der breiten Öffentlichkeit viel besser reüssieren.
Es gäbe also einen großen Aufklärungsbedarf über die Jagd in der Bevölkerung?
Ja unbedingt! Und was ich außerdem in der Gesamtdiskussion vermisse, ist die Sensibilität den Dingen gegenüber. Wir Jäger müssen weg von der Vorstellung, die EU, die Grünen wollen uns die Jagd „wegnehmen“, wenn auch manche Extremgruppierungen das zum Ziel haben. Und wir müssen aufhören zu romantisieren und „Gschichtln“ zu erzählen, sondern klar zu den Fakten stehen. Wir müssen uns den Herausforderungen einer sich verändernden Gesellschaft stellen.
Die da sind?
Wildtiermanagement in der Kulturlandschaft ist bei einigen Arten absolut notwendig, vor allem von Schalenwild, andere Wildarten wiederum dürfen wir jagdlich nutzen. Einerseits produzieren wir dadurch ein hochwertiges und tierschutzgerechtes Lebensmittel, andererseits erlaubt die Gesellschaft ja auch andere Dinge, die keinen höheren Nutzen haben wie etwa, das tausende Motoradfahrer nur zu ihrem eigenen Lustgewinn durch Österreich fahren, weil Motorrad fahren eben auch Freude bereitet. Deshalb darf uns auch, noch dazu mit den Effekten von Fleischproduktion und Wildtiermanagement, die Jagd Freude bereiten!

Warum ist auch gerade die Nutzung nicht managementbedürftiger Wildarten nachhaltig und kann sogar zum Artenschutz beitragen?
Ein gutes Beispiel ist das Auerwild: Viele Waldbesitzer führen waldbauliche Maßnahmen durch, um den Lebensraum auerwildgerecht zu gestalten, damit es erhalten werden kann. Dann kann man alle zwei, drei Jahre einen Auerhahn erlegen – das ist etwas, was man vielleicht einmal im Leben auch selbst macht. Wenn nun die Jagd auf das Auerwild verboten würde, dann würden viele sagen „ich hab‘ eh nichts mehr davon, ob der Vogel da ist oder nicht“, und stellen ihre Bemühungen zur Lebensraumschaffung ein. Oder auch die Anlage von Hecken zur Lebensraumverbesserung von Niederwild. Da sagt auch niemand „oh, dort könnte die Braunerle brüten“, sondern da geht es um die Fasane, Hasen und Rebhühner. Da müssen wir auch ehrlich sein, dass es uns da nicht vorrangig um den Artenschutz geht, die Möglichkeit zur Jagd auf diese Wildarten uns aber anregt, etwas für diese zu tun, was aber auch vielen anderen Lebewesen in der ohnehin übernutzten Kulturlandschaft sehr zu Guten kommt. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
Dafür gibt es ja auch einige internationale Beispiele, wie die Jagd zur Arterhaltung beitragen kann.
Ja, eines der schönsten Beispiele, bei dem mein Bruder auch einer der Unterstützer des Projektes ist, ist das Markhor in Tadschikistan. Es wurde von den Einheimischen als Fleischlieferant gewildert, dann haben noch mafiöse Zustände im Land dazu geführt, dass es eine unregulierte Trophäenjagd gegeben hat und das Markhor ernsthaft bedroht war – und mit ihm übrigens auch der Schneeleopard, weil das Markhor sein Beutetier Nummer eins ist. Zum Glück haben dann ein paar gescheite Leute gesagt „wir müssen den Einheimischen Geld aus den Erlösen der Jagd zukommen lassen, dann werden sie sich um das Markhor kümmern“. Und so war es dann auch. In dem Gebiet, in dem sich mein Bruder engagiert, gab es bei der letzten Zählung nur mehr rund 350 Tiere, bevor man mit diesem Programm begonnen hat. Heute gibt es dort etwa zehnmal so viele und es werden 5-6 Trophäenabschüsse im Jahr verkauft. Das Markhor ist übrigens auch die teuerste Trophäe der Welt – ein Abschuss kostet rund 150.000 Euro. Mittlerweile lebt ein Dutzend Familien von der Berufsjägerei,
wobei das in erster Linie Markhor-Bewachung ist. Auch die Wildschweine, die sie vorher vergiftet haben, werden mittlerweile zum Abschuss freigegeben. Das Geld, das dadurch ins Land kommt, trägt nicht nur zur Bestandssicherung des Markhors, sondern generell zu einem steigenden Wohlstand der in diesen Gebieten lebenden Bevölkerung bei.
Bei welchen Themen bräuchte es deiner Meinung nach noch ein Umdenken auf dem Weg zu einer ethikbewussten Jagd?
Der größte Hebel ist sicher die Jagdausbildung. Es muss schon in den Jungjägerkursen echte Diskussionen und Auseinandersetzungen um ethische Themen geben. Das Problem ist da die sehr unterschiedliche Organisation der Jagdausbildung. Es wäre wünschenswert, wenn die Jagdausbildung zumindest auf Bundesländerebene zentral organisiert wäre. Aber auch, dass sich die Jagdverbände auf ein österreichweites Leitbild einigen. Wir sollten uns einigen als Jägerschaft, was letztlich unsere Go‘s und No-go‘s sind. Und was wir immer wieder übersehen: wir müssen bedenken, dass die Rahmenbedingungen für die Jagd immer die Gesellschaft vorgibt.

Bräuchte es darin auch vermehrt Diskussionen zum Begriff der Weidgerechtigkeit?
Natürlich. Der Begriff muss einem ständigen Wandel unterlegen sein. Er muss sich verändern und anpassen. Nicht nur an die Erkenntnisse der Wissenschaft, sondern auch an die Einstellung der Menschen heute zu Lebewesen ganz generell.