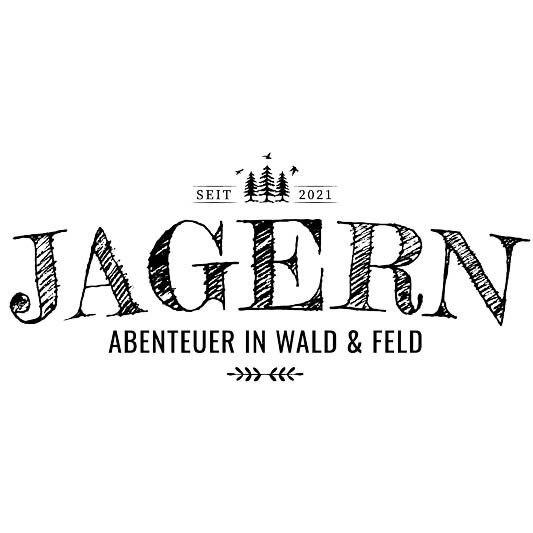Liebe Tamara, könntest du uns als Erstes bitte einen kleinen Einblick in dein Handwerk geben?
Wir haben eine kleine, aber feine Imkerei zu Hause und schauen zusammen im Familienverband darauf, dass es unseren Tieren gut geht. Das beginnt im Frühjahr, so gegen Ende Februar, Anfang März. Als Erstes versucht man da zu überprüfen, ob nach der langen Winterzeit überhaupt noch Leben im Stock ist. Das muss zunächst sehr vorsichtig geschehen, weshalb wir die Fluglöcher im Auge behalten oder auch einmal sanft an die Beute klopfen und nach dem Summen lauschen.
Beuten sind die kleinen Holzhäuschen, die wir den Bienen als Ersatz für die ursprünglich von ihnen genutzten Baumhöhlen bieten. Die winterliche Kälte stellt eigentlich kein Problem für sie dar, denn durch das Zusammenkuscheln (Wintertraube) und Vibrieren der Flugmuskeln entsteht Wärme und so kann die Temperatur in einem Stock auf dem erforderlichen Niveau zwischen 15 und 36 Grad Celsius gehalten werden. Futtermangel oder die Varroamilbe können unseren kleinen Honigproduzenten aber gefährlich werden. Besonders diese nur millimetergroßen Schmarotzer bedrohen das Überleben des ganzen Volkes, da sie nicht nur die Bienen durch Saugen an Körpersäften schwächen, sondern auch Krankheiten übertragen. Einfach aufmachen und in den Stock hineinschauen geht nicht, da sonst die mit viel Aufwand erzeugte Wärme entweicht und die Bienen erstarren und sterben würden.
Selbst im Sommer braucht es nach einem Öffnen des Bienenstocks um die drei Tage, bis sich das Raumklima für die Bienen im Stock wieder normalisiert hat. Ist das Gröbste überstanden, bieten früh blühende Pflanzen wie Palmkätzchen (Salweide), (Wild-)Krokusse, Schneeglöckchen oder die Traubenhyazinthe erste Pollennahrung, welche von den überlebenden Winterbienen gesammelt wird und mit deren Hilfe die nächste Generation der Sommerbienen gefüttert wird. Als Imkerin muss ich also eine relativ lange Periode der Ungewissheit aushalten und hoffen, dass ich vor dem Winter alles richtig gemacht habe. Honig ernten kann man frühestens Ende Mai, wobei es natürlich immer auf den Standort ankommt. In wärmeren Regionen geht es früher, in kälteren erst später im Jahr. Wenn das Volk schnell wächst, müssen rechtzeitig neue Zargen auf die Beute gesetzt werden, um den Bienen genügend Platz zu lassen. In unserer Imkerei versuchen wir, unsere Tiere so wenig wie möglich zu stören, ihnen aber gleichzeitig alles Nötige zu geben. Wenn alles gut gelaufen ist, kann man dann Honig ernten. Als Ausgleich bekommen die Bienen dann eine Zuckerlösung, wobei wir ihnen schon immer so 10 bis 20 Prozent des produzierten Honigs überlassen.
Man kann stark davon ausgehen, dass das so wesentlich gesünder fürs Volk ist. Als Mensch könnte man zwar beispielsweise auch den ganzen Winter über nur Fast Food essen und würde dabei nicht verhungern, gesund wäre das Ganze aber eindeutig nicht. Wir achten wirklich darauf, dass es unseren Völkern gut geht, ähnlich wie bei einem leidenschaftlichen Landwirt und seinem Vieh.
Wie wichtig sind Bienen denn für uns Menschen?
Die Honigbiene ist das drittwichtigste Nutztier weltweit, gleich hinter Rind und Schwein. Geflügel etwa kommt erst danach. Rund 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen weltweit sind auf die Bestäubungsleistung angewiesen, somit stellt diese unverzichtbare Arbeit ganz klar die Hauptleistung der Bienen für den Menschen und die Natur dar, da nur vergleichsweise wenige Getreide- sowie Salatsorten und vielleicht noch die Kartoffel ohne sie auskämen. Aufgrund der hohen Bedeutung auf dem Feld der Nahrungsmittelsicherheit stellen also Honig, Wachs, Gelée royale und Propolis im Grunde Nebenprodukte der Bienenhaltung dar.
Die Bestäubungsleistung weltweit wird mit ca. 300 bis 500 Milliarden Euro beziffert (Kakao, Kaffee, Mandeln, Medizinpflanzen, Baumwolle, Obst und Gemüse). Diese Leistung der Insekten ist enorm und für die Wirtschaft sowie unsere Lebensmittel unverzichtbar.
Wie bist du denn zur Imkerei gekommen?
Das ist jetzt sicher schon an die zwölf oder dreizehn Jahre her, da hat uns ein Freund zu seinen Bienenstöcken mitgenommen und uns alles erklärt. Da wurden mein Mann und ich von der Faszination für dieses Insekt gepackt. Wir wollten auch etwas direkt für die Natur machen. Wir wollten zudem den Kindern zeigen, wie wichtig es ist, zu wissen, woher unsere Nahrung kommt, wie wichtig es ist, die Kreisläufe zu erkennen und zu unterstützen. Die Kleinen waren somit ausschlaggebend, da wir ihnen eben dieses Wissen mitgeben wollten. Wir legten uns also die ersten Bienenstöcke zu, am Anfang waren es drei, doch wurden es mit der Zeit bald immer mehr. Jetzt betreiben wir schon seit über zehn Jahren eine Imkerei und sind nach wie vor mit viel Leidenschaft dabei: Unser Honig ist Bio-zertifiziert und daneben produzieren wir auch weitere Schätze aus dem Bienenstock wie Propolis-Tropfen, Lippenbalsam oder Bienenwachskerzen.
Letztere sind viel wertvoller als die handelsüblichen Paraffinkerzen auf Erdölbasis. Nur spezielle Bienen in einer gewissen Altersgruppe stellen das Wachs her, welches als Baumaterial im Stock dient. Bienenwachskerzen zeichnen sich durch ihren besonderen Duft und ihren Kerzenschein aus, dem man nachsagt, dass er dem Sonnenlicht von allen Kerzen, die es gibt, am nächsten kommt. Im Mittelalter waren sie aufgrund ihres Wertes meist nur Adeligen und Kirchenleuten vorbehalten. Im Vergleich zu den Talgleuchten und Kienspänen des einfachen Volkes haben die Wachskerzen weitaus besser gerochen und weniger Ruß produziert.
Ihr bietet auch sogenannte „Bienenpädagogik“ an. Was kann man sich denn konkret darunter vorstellen?
Wir versuchen, bei unseren Vorträgen und Workshops nicht einfach nur von unserer Tätigkeit als Imker zu erzählen, sondern das Thema spannend und mit praktischem Einbezug aufzubereiten. Dabei sind wir vom LFI Salzburg (Ländliches Fortbildungsinstitut, eine Bildungseinrichtung der Landwirtschaftskammer; Anmerkung d. Redaktion) zertifiziert.
Die notwendigen Kenntnisse wurden uns bei einer Schulung durch die imker.ag über sechs Monate hinweg intensiv vermittelt. So habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Begeisterung für Bienen professionell weiterzugeben. Hauptsächlich Kinder sollen so mittels Erlebnispädagogik das Wichtigste über diese besonderen Insekten lernen, doch biete ich auch Vorträge für interessierte Erwachsene an, etwa über Wildbienen. Den wilden Verwandten der Honigbiene kann man z. B. oft schon mit kleinen Maßnahmen sehr große Unterstützung zukommen lassen und diese brauchen sie dringend. Ich setze mich als Imkerin ganz bewusst nicht nur für die Honigbienen ein, denn die Wildbienen brauchen eine starke Lobby, die ihnen eine Bühne bietet. Es muss da kein Konkurrenzverhältnis bestehen, denn es werden alle Bienen dringend gebraucht.
Das Schöne an meiner Tätigkeit ist, dass Kinder eine gesunde Neugierde haben und mit den richtigen Methoden leicht für solche Themen zu begeistern sind. Wenn es von der Saison her geht, nehme ich lebendige Bienen zu meinen Workshops in einem Schaukasten mit. In der kalten Jahreszeit müssen eben Fotos herhalten. In der Weihnachtszeit biete ich zum Beispiel auch Kerzengießen an.
Wie würdest du das Verhältnis unserer Gesellschaft zur Natur beschreiben?
Ich glaube, die Menschen suchen schon wieder gezielter die Wurzeln. Sie sind interessiert und da muss man sie aufklären. Es kursiert immerhin die eine oder andere Falschinformation, etwa dass man die Bienen gänzlich in Ruhe lassen sollte mit der Imkerei. Doch durch die in den 70ern eingeschleppte Varroamilbe sterben die Tiere ohne professionelle Pflege einfach alle weg. Es gibt nur mehr sehr wenige wirklich unbetreute Völker, denn an die 80 Prozent der Honigbienen gehen eben in der freien Wildbahn an der Milbe zugrunde. Das kann nicht im Sinne des Natur- oder Tierschutzes sein. Die Honigbienen gehen auf sogenannte „Massentrachten“, also große Ansammlungen von Blüten, wie man sie in der Landwirtschaft mit ausgedehnten Sonnenblumen-, Raps- oder Lavendelfeldern findet. Wenn Imker mit Landwirten zusammenarbeiten, hat da jeder einen Nutzen davon: Erstere bekommen einen reinen Sortenhonig, Zweitere können in Folge der Bestäubung auf eine gute Ernte hoffen. Das Aufstellen von Honigbienenstöcken in Schutzgebieten mit seltenen Pflanzen sehe ich dagegen kritisch, da diese Areale den besonders bedrohten Wildbienen vorbehalten bleiben sollten.
Gerade diese sind nämlich schon von ihrem Körperbau her oft nur auf eine Handvoll Gewächse spezialisiert. Die Zeit der Jungenaufzucht fällt mit dem heimischen Blütezeitpunkt zusammen, weshalb Honigbienen eine unerwünschte Nahrungskonkurrenz darstellen können. Da braucht es Aufklärung, denn im Bereich der Landwirtschaft ist das Imkern unverzichtbar, bei den angesprochenen Naturschutzflächen schaut das aber eben anders aus. Beim Ausbringen von Saatgut etwa sollte darauf geachtet werden, keine fremden Arten einzuschleppen, die womöglich heimische Arten verdrängen. Bei exotischen Samenmischungen weiß man ohnehin nicht, ob die Pflanzen dann überhaupt in unseren Breiten aufgehen und unseren Bienenarten überhaupt Nahrung bieten.
Es gibt aber auch Grenzfälle: Zum Beispiel beim aus Asien stammenden Springkraut sind wir Imker geteilter Meinung. Das blüht von Juni bis Oktober, wo ansonsten die meisten heimischen Pflanzen entweder verblüht oder abgeerntet sind. Bienen und Hummeln nehmen das Springkraut in dieser Zeit folglich gerne als dringend benötigte Nahrungsquelle an. Andererseits breitet sich das eingeschleppte Kraut immer weiter aus und verdrängt dabei Teile der hiesigen Flora. Dabei könnte jeder Gartenbesitzer den Bienen ganz einfach bei der Nahrungssuche weiterhelfen, auch ohne fremde Pflanzenarten. Was dem einen nur ein verwildertes Gestrüpp ist, ist dem anderen ein regelrechtes Bienenbüffet. In Wohnräumen ist Sauberkeit klarerweise sehr wichtig, im Garten hat sie jedoch eigentlich nichts verloren. So ist ein abgestorbener Baum von Haus aus das beste Insektenhotel überhaupt und bietet Arten wie der Blauschwarzen Holzbiene ganz ohne menschliches Zutun Unterschlupf.
Mit solchen Tipps möchte ich den Menschen auf jeden Fall stets mitgeben, dass es oft ganz einfach ist, der Natur nachhaltig zu helfen, oder wie Karl Ploberger immer sagt: Der faule Garten ist eigentlich der bessere Garten!
Auch als Imker muss man der Natur wohl oft ihren Lauf lassen?
Ja, das wird wohl am stärksten beim Schwärmen deutlich. Da verlässt die alte Königin mit ca. der Hälfte des Volkes den Stock, um anderswo einen neuen aufzubauen. Indessen schlüpft eine neue Königin, die dann die alte Behausung übernimmt. Vorher machen eigene Kundschafterbienen geeignete Nistplätze wie etwa alte Spechthöhlen ausfindig, wobei sie ihren eigenen Körper zum Ausmessen des Platzangebots nutzen. Das Ausschwärmen ist zwar die natürlichste Art der Vermehrung und leistet einen wichtigen Beitrag zur genetischen Vielfalt, bedeutet für den Imker aber auch einen Einkommensverlust, da die halbierte Zahl an Bienen natürlich auch weniger Honig liefert. Der Honig selbst dient nicht nur als Vorrat für den Winter, sondern ist sozusagen auch der Treibstoff aller Aktivitäten rund um den Stock. Mit so einer „Tankfüllung“ in ihrem Magen kann eine Biene ungefähr 5 Kilometer weit fliegen.
Derartig weite Strecken legen sie aber nur in Ausnahmefällen zurück, meistens werden kürzere Distanzen abgedeckt, das dafür aber durchschnittlich 10- bis 15-mal am Tag, und es werden ca. 150 bis 250 Blüten besucht. Wanderimker können die Wege ihrer Bienen dadurch lenken, dass sie die mobilen Stöcke je nach Blütezeit in der Nähe von speziellen Kulturen wie etwa Marillenhainen aufstellen. Hiervon profitieren nicht allein die Besitzer der bestäubten Bäume, da sich so ein Honig mit besonderem Geschmack gewinnen lässt. Im Gegenzug können Landwirte, die sich zum Ausbringen von Insektiziden gegen Schädlinge gezwungen sehen, dies in Absprache mit den Züchtern erst am Abend tun, wenn die Bienen im Stock ruhen. Klar wäre es besser, wenn es einen anderen Weg ohne Gift gäbe, aber mit etwas Koordination lässt sich immerhin schon viel gewinnen. Den Wildbienen kann ebenso oft durch etwas Zusammenarbeit deutlich geholfen werden.
Die sind nämlich meist kleiner als die Honigbienen, was viel geringere Flugdistanzen zur Folge hat und weshalb sie noch viel stärker auf Blühstreifen angewiesen sind. Einzelne Blühinseln können noch so viel Blütenreichtum aufweisen, wenn sie zu weit auseinanderliegen, kann kein genetischer Austausch stattfinden, was die Anpassungsfähigkeit der vielen Bienenarten und damit ihre Überlebenschancen reduziert.
Welche Bezüge bestehen für dich zwischen Imkerei und Jagd?
Die Jagd gibt es ja schon sehr lange und sie diente dem Menschen über Jahrtausende zum Erwerb von Fleisch, Fellen und Leder. Unsere steinzeitlichen Vorfahren aßen aber auch gern den süßen Honig, wie eine ca. 10.000 Jahre alte Felsmalerei von der Bewunderung eines Bienennestes in Spanien zeigt. Die alten Ägypter und Griechen wussten ebenso, was sie an den kleinen Insekten hatten. Das ist schon ein langer gemeinsamer Weg. Deshalb bestehen Parallelen in der Geschichte zwischen der Jagd und der Imkerei. In beiden Bereichen geht es letztendlich um eine Koexistenz von Mensch und Tier.
Der Mensch macht sich das Tier zunutze, hegt und pflegt es im Gegenzug und nimmt sich günstigenfalls seinen Teil, ohne den Fortbestand dieses Systems zu stören. Da muss nachhaltig vorgegangen werden, so wie ich nicht den ganzen Honig bis zum letzten Tropfen für mich abschöpfen kann. Der Erhalt einer gesunden Population ist somit das oberste Ziel von Jagd und Imkerei gleichermaßen. Vielfalt ist dabei im genetischen wie im landschaftlichen Sinne das Zauberwort. Die große Herausforderung hierbei wird wohl für uns sein, den Leuten wieder den Wert des Regionalen vor Augen zu führen. Lebensmittel wie Obst, Wildbret oder eben Honig aus der Region sind in der Regel hochwertiger, klimafreundlicher und am Ende gesünder sowie schmackhafter als irgendwelche Importe von weit her. Diese Qualität schlägt sich in höheren Preisen nieder, doch sollte meiner Ansicht nach jedem eine gesunde Ernährung ermöglicht werden.
Hab vielen Dank für den Einblick in deine Zunft. Wie wünschen dir und deiner Familie alles Gute und weiterhin viel Erfolg!