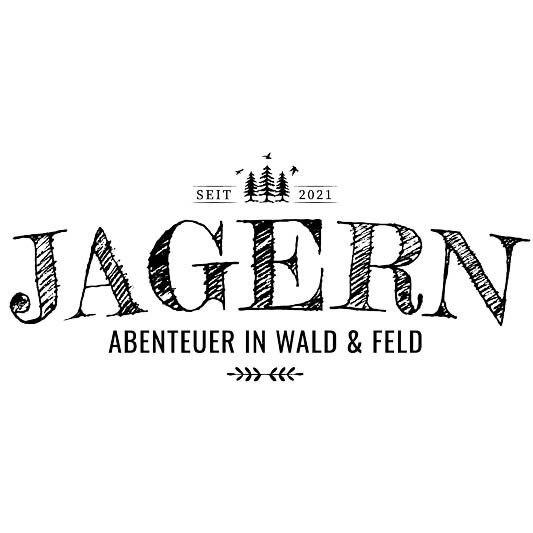In der letzten Ausgabe haben wir uns dem Thema Wunden gewidmet. Ihr habt einen Überblick über die verschiedenen Arten von Wunden erhalten und eine Kurzanleitung zu deren Versorgung sowie eine Empfehlung für den Mindeststandard eines „Jagdverbandspäckchens“ bekommen. In diesem Artikel möchte ich Wundarten aufzeigen, die besondere Beachtung verdienen, sogenannte „Red Flag“-Wunden. Konkret heißt das – solche Wunden muss immer ein Arzt sehen!
„Red Flag“-Wunden bedürfen besonderer Beachtung, da bei nicht fachgerechter Versorgung und Behandlung langdauernde, im schlimmsten Fall irreparable Funktionsstörungen oder -ausfälle unseres Körpers drohen. Bei richtiger Therapie heilen sie aber in fast allen Fällen folgenlos aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass beim Auftreten dieser Verletzungen eure „inneren Alarmglocken“ läuten.
Verletzungen an Fingern und Hand
Die Hand ist feingliedrig und komplex aufgebaut: Muskeln und Gelenke können sich viel-fältig und mit großer Präzision bewegen, auch die Kraftverteilung ist optimal. Die Hände können fest zupacken und mit schweren Gewichten hantieren, aber auch feines Garn durch ein Nadelöhr fädeln. Die Hand selbst ist sehr verletzlich, denn die relativ dünnen Knochen, die Sehnen, Nerven und Blut-gefäße liegen direkt unter der Haut und sind von nur wenig schützendem Gewebe bedeckt. Aus die-sem Grund sind bei Schnitt- und Stichverletzungen die Beuge- und Strecksehnen sehr gefährdet, die Muskeln und Knochen verbinden und über Querverbindungen miteinander gekoppelt sind. Sie sind teilweise von schützenden Hüllen umgeben, den Sehnenscheiden, die Flüssigkeit enthalten, die als Schmiermittel dient und für reibungsarme Be-wegungen sorgt. Bei Schnittverletzungen kommt es sehr häufig zu einer Mitverletzung der Sehnen, nur ist das durch die Stellung der Finger beim Zufügen der Verletzung oft schwer zu erkennen. Meist schneiden wir uns in die „Hilfshand“, mit der wir das Objekt (z. B. Wild beim Aufbrechen) festhalten. Unsere Finger sind dabei gebeugt, die Faust ist geschlossen. Wenn wir uns in dieser Stellung schneiden, lassen wir danach los, und die Finger kommen in eine Streckstellung, der verletzte Sehnenteil „verschlüpft“ unter die Haut und die Sehnenverletzung ist nicht gleich zu erkennen. Um eine solche dennoch nicht zu übersehen, müssen derartige Wunden unbedingt von einem Arzt begutachtet und versorgt werden. Besonders heimtückisch sind Stichverletzungen an der Handinnen- beziehungsweise Fingerinnenseite. Da die Beugesehnen von Sehnenscheiden umhüllt sind, finden sich hier Räume zwischen Sehne und Sehnenscheidenwand, in denen sich eitrige Entzündungen ungehindert ausbreiten können. An eine Verletzung der Beugesehnenscheiden ist bei jeder, auch noch so kleinen Stichverletzung im Be-reich der Hand- und Fingerinnenseite zu denken. Sollte es zu einer solchen kommen, und diese über-sehen werden, sind die Folgen gravierend. Da diese eitrigen Entzündungen entlang der Beugesehnen fulminant verlaufen, besteht beim Auftreten von Symptomen – Rötung, Schwellung und Schmerzen beim Strecken des betroffenen Fingers – bereits akuter Handlungsbedarf. Es muss eine Notoperation vorgenommen werden, um die Entzündung in den Griff zu bekommen. Die Nachbehandlung ist sehr langwierig und oft bleiben Folgeschäden zurück. Eine solche eitrige Entzündung der Beugesehnen (Panaritium tendineum) führt häufig zu einer Einschränkung der Handfunktion.
Schnitt- oder Stichverletzungen an der Handoder den Fingern: was tun?
▶ Wunde reinigen
▶ mit einem sterilen Verband abdecken
▶ Patient ins Krankenhaus bringen – auch bei noch so kleinen Stichwunden
▶ Schnitt- und Stichwunden innerhalb von sechs Stunden ärztlich versorgen lassen!
Bissverletzungen
Auf jedem Zahn sitzen Bakterien, daher muss jeder Biss antibiotisch behandelt werden. Bei größeren Bissverletzungen ist auch eine chirurgische Wundversorgung nötig. Im Gegensatz zu Hundebissen, welche großflächig mit einer Reiß- und Quetschkomponente sind, sind Katzenbisse primär klein, unscheinbar und dennoch tückisch. Durch die Art der Bissbewegung und die schmalen, spitzen Zähne sind die Wunden an der Haut meist sehr klein und verheilen an der Oberfläche rasch. Es entsteht eine Wundhöhle, die nach außen abgeschlossen ist. Die mit dem Biss eingebrachten Bakterien erhalten dadurch einen „geschützten Lebensraum“, in dem sie sich ungehindert vermehren und die Entzündung vorantreiben können. Eine Sonderform der Bissverletzungen stellen Schlangenbisse dar. Hier kommen neben Bakterien – daher müssen auch Bisse von ungiftigen Schlangen ärztlich versorgt werden – auch Gifte in unseren Körper. Die Wirkung eines Schlangengifts hängt von seiner Zusammensetzung, der beim Biss injizierten Menge – beim Verteidigungsbiss wird weniger Gift ausgeschüttet als beim Jagdbiss – sowie davon ab, ob Muskeln oder Blutgefäße getroffen wurden. Die Zusammensetzung der Schlangengifte ist artspezifisch, sehr komplex und ändert sich jahreszeitlich. Hauptkomponenten sind toxische Proteine, die eigentlich ein rasches Erlegen der Beute gewähr-leisten sollen, sowie giftig wirkende Enzyme, deren Funktion in der Förderung der Giftausbreitung und in der Einleitung und Unterstützung der Verdauung liegt. Aufgrund des Wirkmechanismus unter-scheiden wir grob zwei Giftarten. Zum einen solche, die ausgeprägt zellschädigend wirken – sie äußern sich durch Schmerzen, Schwellungen und Nekrosen – und zum anderen jene mit nervenschädigender Wirkung. Letztere führen zu Lähmungen oder Ausfallserscheinungen. Zusätzlich sind in den Schlangengiften Substanzen enthalten, welche die Blutgefäße erweitern und „undicht“ machen. Des Weiteren kann es zu Störungen der Blutgerinnung und durch die allergene Wirkung der Gifte zusätzlich zu einem allergischen Schock kommen. Der Schlangenbiss zeigt sich meist in Form von zwei nebeneinanderliegenden, punktförmigen Einbiss-stellen. Falls eine Giftschlange zugebissen hat und dabei tatsächlich Gift injiziert wurde, entwickeln sich weitere Symptome – in der Regel innerhalb von 15 bis 30 Minuten, manchmal aber auch erst einige Stunden nach dem Biss. Es hängt wesentlich von der Zusammensetzung und Dosis der injizierten Giftmischung ab, welche Symptome auftreten, wie heftig diese sind und wie gefährlich es für den Patienten werden kann. Am häufigsten kommt es in unseren Breiten zu Kreuzotterbissen. Das Gift der Kreuzotter ist für einen gesunden erwachsenen Menschen relativ harmlos, die Symptome nach einem Biss können aber massiv sein. Wurde bei einem Kreuzotterbiss ausreichend Gift injiziert, bildet sich um die Bissmarke rasch eine schmerzhafte Schwellung. Diese kann sich bläulich verfärben und sich auf die gesamte Extremität und noch weiter ausbreiten. Häufig schwellen zu-dem die Lymphknoten in der betroffenen Körperregion an und die Lymphgefäße entzünden sich. Darüber hinaus zeigen viele Patienten nach einem Kreuzotterbiss zum Teil heftige Panikreaktionen. Allgemeinsymptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen werden ebenfalls manchmal beobachtet. Nur in seltenen Fällen entwickeln sich schwerere Vergiftungssymptome. So kann sich etwa an der Bissstelle eine bläuliche Blase bilden und Gewebe absterben. Auch schwere Kreislaufprobleme mit Herzrasen, Blutdruckabfall und Kreislaufschock sind eher die Ausnahme. Die Erste Hilfe zielt hier vor allem darauf ab, eventuelle Giftwirkungen zu verzögern, bis der Patient ärztlich versorgt werden kann. Außerdem geht es darum, die Schmerzen und Angst des Patienten zu verringern.
Schlangenbiss – was tun?
▶ Betroffenen beruhigen und aktive Bewegung meiden▶ Wunde versorgen▶ Schmuck/Kleidung entfernen▶ Patient ins Krankenhaus bringen oder den Rettungsdienst rufen
Prim. Dr. Martin Pelitz ist Unfallchirurg, ärztlicher Leiter des Reha-Zentrums Bad Hofgastein und begeisterter Jäger.