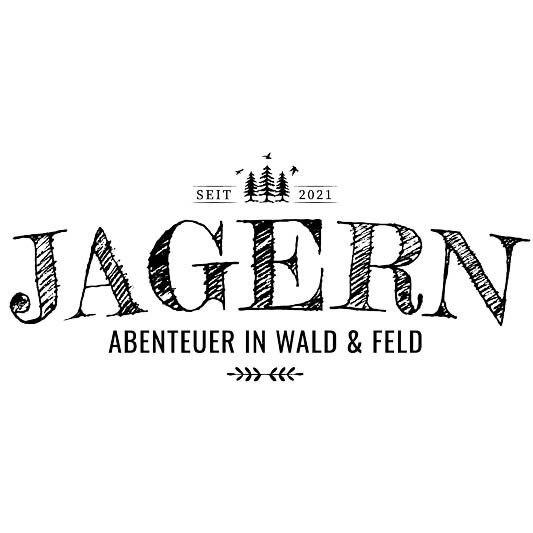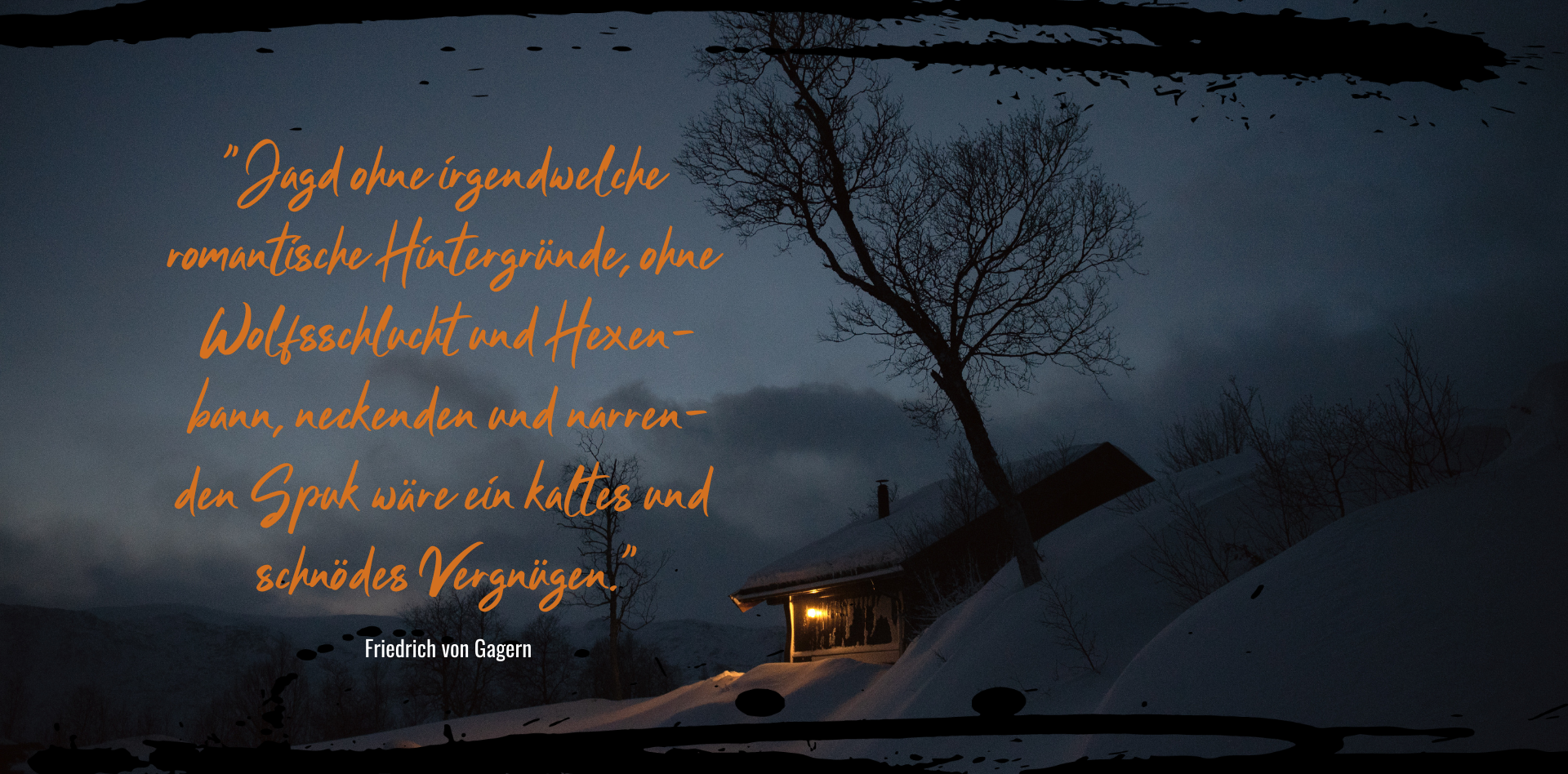Kaum ein Bauernhof, kaum ein Haus, eine Wohnung, wo heutzutage nicht zu den Weihnachtstagen in Apotheken oder auf Christkindlmärkten gekaufte Rauhnachtsräuchermischungen, meist mit Weihrauch versetzt, verräuchert werden. Kaum jemand, dem das „Rauhnachtsräuchern“ fremd ist, so tief verwurzelt und verankert ist dieser jahrtausendalte Brauch. Mit welchen heimischen Kräutern, Hölzern, Wurzeln und Harzen lässt es sich also am besten räuchern? Und was hat es mit den anderen Bräuchen rund um die Wintersonnenwende auf sich? Wer ist die Percht und wer oder was ist die Wilde Jagd?
Rauhnächte in der Weihnachtszeit
Mit der „Armenseelenwoche“ dem Ahnen- und Totenfest Allerheiligen, Allerseelen, der Hubertusnacht von 2. auf 3. November und dem Martinstag am 11. November beginnt traditionell die auf Weihnachten hinzielende stillste Zeit im Jahr. Die Weihnachtszeit selbst endet mit Maria Lichtmess am 2. Februar. Die Rauhnächte – auch Rauchnächte oder Raunächte genannt – beginnen heute meist mit der mystischen Thomasnacht von 20. auf 21. Dezember und enden mit der lichten Perchtennacht, die vielerorts auch die Glöcklernacht ist, von 5. auf 6. Jänner. In wilde und milde, feiste und dürre Rauhnächte wird dabei unterschieden. Das Feiern und das Fasten sowie regional teils unterschiedliche Heischebräuche1, wie das Anklopfen oder Anglöckeln, bestimmen das gesellschaftliche Leben in dieser besonderen Zeit. Überregionale Gebote und Verbote, wie dass in den 13 heiligen Nächten der Stall nicht ausgemistet werden darf, keine Wäsche gewaschen und aufgehängt werden sollte, alle Schulden des letzten Jahres beglichen sein sollten uvm. sind vielen noch heute sehr geläufig. In der Zeit der Rauhnächte geht es im Allgemeinen darum, das Alte gut sein zu lassen, zu bereinigen, zu befrieden und erste Blicke, mittels Orakelbräuche, in die Zukunft zu tun. Was aber macht die Rauhnächte so mystisch, ehrfürchtig und geheimnisvoll?
Von Perchten und der Wilden Jagd
Im Alpenraum spielt die Percht, eine mystische weibliche Sagengestalt, welche bis ins 16. Jahrhundert hierzulande als segens-und heilbringende, gerechte Göttin verehrt wurde, eine zentrale Rolle. Von der Percht leiten sich auch die heutigen schaurigen Perchtenpassen ab, welche ab November in dämonischen Ziegen- und Steinbockgestalten nach Einbruch der Dunkelheit anzutreffen sind. Mit Getöse und Gegröl rütteln sie an unseren Schattenseiten und Ängsten, um diese ins Bewusstsein zu bringen und somit besieg- und heilbar zu machen. Die gefürchtete Wilde Jagd jault, blädert, klagt und kauzt in den Rauhnächten2 durch die Lüfte und über das Land hinweg. Je nach Kulturkreis wird die Wilde Jagd von unterschiedlichen Gottheiten angeführt. Im Norden ist es der alte Waldgott Wotan oder der Frey und seine Schwester Freya (germanische Gottheiten der Fruchtbarkeit, der Liebe und der Jagd), welche auf Keilern reitend das Gefolge anführen. Andernorts ist es die römische Jagdgöttin Diana oder die alpenländische Percht, welche die furchterregende Jagdgesellschaft leitet und anführt. Percht wie auch Diana gelten als Gamshüterinnen, Hüterinnen und Beschützerinnen von Wild und Wald. Vor allem die Gams – symbolisiert durch die weiße Habergoas als zentraler Bestandteil einer Perchten-pass – steht unter ihrer Schutzherrschaft. Gerade dann, wann sich die Percht und ihr Gefolge zeigen, ist Brunftzeit bei den sogenannten Bergteufeln, bei Gams- und Steinwild, und hohe Rauschzeit beim Schwarz-wild. Beim Rehwild hingegen endet die Eiruhe und der Sonnenhirsch hat sich in den verschneiten Wald in Stille und Ruhe zurückgezogen. Die Natur gibt den Rhythmus des gesellschaftlichen Lebens der Menschen und die daraus entstandenen Symboliken und Glaubensvorstellungen vor.
Warum überhaupt eine „Wilde“ Jagd?
Überlieferungen gibt es hier natürlich viele. Feststeht, dass es alte Weise bzw. Jagd- und Fruchtbarkeitsgottheiten sind, welche die „Wilde Jagd“ anführen und leiten. Mehrfach überliefert ist, dass es sich in dem Gefolge um zu läuternde Jäger und Jägerinnen handelt, welche zur Wilden Jagd verdammt wurden, da sie wiederholt wider die Gesetze der Natur gehandelt haben, grausam zu Tier, Wild und Mensch waren. Vielfach und aus jüngerer Zeit ist überliefert, dass es sich beim Zug der heulenden Wilden Jagd um die heilbringende Percht und verstorbene, nicht erlöste Kinderseelen handle, was sich mit den Traditionen zum Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember in Einklang bringen lässt. Wer auch immer sich im Gefolge der Wilden Jagd verbirgt: „Glück hinein, Unglück hinaus, es zieht das Wilde Gjoad ums Haus!“, heißt es rund um den Salzburger Untersberg seit Jahrhunderten. Dies verdeutlicht die im Grunde wohlwollenden Absichten, der dämonisch scheinenden Perchtenbräuche und der Wilden Jagd: nämlich Licht, Segen, Gesundheit und vor allem Fruchtbarkeit über das Land zu bringen – die Dunkelheit gebiert das Licht im Kreislauf des Lebens. Heute ist es vielerorts bei uns auch wieder der Weihnachtsmann – der alte „saturnische“ Weise aus dem tiefen ewigen Wald – der mit einem Rentiergespann wohlwollend durch die Lüfte reitet und Segen und Fruchtbarkeit bringt.
Jagdliche Bräuche
Obacht vor der Wilden Jagd ist demjenigen geboten, der an Tagen wie Allerheiligen oder gar an hohen Rauhnächten (24./25. Dezember, 31. Dezember/1. Jänner) auf die Pirsch geht. Das ist in Österreich und Deutschland verpönt. Es gibt aber auch Rauhnächte an denen, wiederum regional unterschiedlich, gejagt werden darf und sogar sollte – die beliebte Stefanijagd auf Hochwild ist ein bekanntes Beispiel dafür. In der Zeit der Rauhnächte auf Hasenjagd zu gehen, gilt jedoch seit jeher als frevelhaft und ist Gegen-stand beliebter Legenden und Sagen. Nach überliefertem jagdlichem Brauch sollen alle Jagdutensilien in der Rauhnachtszeit säuberlichst geputzt an ihren zugewiesenen Platz stehen. So manche Perchtengestalt – konkret die Pinzgauer Schnabelpercht – kontrolliert nämlich den Reinheitsgrad des Hausstands. Jagdhunde dürfen jetzt auch nächtens in die Stube, damit sie die „Wilde Jagd“ nicht mitnimmt und dem Wild und dem Vieh im Stall wird mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit mit einer besonders wert-vollen Futtervorlage wohl getan.
Zusammensein und „weihrauchen“ gehen
Nach Anbruch der Dunkelheit wird traditionell an zumindest vier Rauhnächten mit dem qualmenden Räucherpfandl im Familienverband gemeinsam durch Haus, Hof und Stall gegangen. In der „ersten“ Rauhnacht, der Thomasnacht am 20. Dezember, am Heiligen Abend, in der Altjahrs-nacht (Silvester) und in der letzten Rauhnacht, in der Perchten- oder Glöcklernacht von 5. auf 6. Jänner.
Von Allerseelen bis zur Wintersonnenwende räuchert man am besten mit reinigendem, weg-weisendem Räucherwerk wie Eibennadeln, Wa-cholder, Hollerblüten und -blätter, Waldengelwurz und Eschenholz sowie -blätter.Diese Gehölze stellen allesamt eine geschützte, gesegnete Verbindung her zwischen dem „Diesseits und Jensseits“, zwischen Dunkelheit und Licht.Eine erwähnenswerte traditionelle Mischung ist auch Meisterwurz (Kraut und Wurzel), Hirschhorn-mehl und Tannenharz. Meisterwurz, auch „Königin der Alpen“ genannt, ist ebenso stark reinigend und stärkend, Hirschhornmehl3 hat im Grunde dieselbe desinfizierende und verstärkt lichtbringende Wir-kung und ergänzt optimal das Tannenharz, welches besänftigt, beruhigt und wie der Weihnachtsbaum aus dem immergrünen Nadelholz Geborgenheit und das ewige Leben symbolisiert.Ab der Thomasnacht ist es ein alter Volksbrauch mit heimischen Nadelholzharzen (Tanne, Lärche, Kiefer, Fichte) gemeinsam mit Mistel sowie mit den licht- und segensbringenden Schutzkräutern wie Schafgarbe, Johanniskraut, Beifuss, Rainfarn aus
dem Maria-Himmelfahrts-Weihkräuterbüscherl Haus, Hof und Stall zu räuchern. Kräuter aus dem Weihkräuterbüscherl werden in der Rauhnachtszeit auch dem Vieh und dem Wild unters „Gleck“4gemischt. Wenn die „Wilde Jagd“ in Form von Sturm und pfauchendem Wind gar schauderhaft an Fenstern und Türen rüttelt, können geweihte Palmkätzchen aus dem Palmbuschen mit verraucht werden. Da die Rauhnächte ja auch seit jeher als Orakelnächte gelten, kann auch ein kleinwenig Bilsenkraut, Ebereschenholz und -blätter, sowie Quendel mit den oben vorgestellten Rauhnachtsräucherwerken verraucht werden. Ein Richtig oder Falsch was die Auswahl der heimischen Kräuter, Wurzeln, Hölzer und Harze anbelangt, gibt es meiner Ansicht nach nicht, doch birgt die regionale Flora viele Schätze. Wer dennoch lieber mit den stimmungsvollen und sehr aromatischen fremdländischen Harzen wie Weihrauch und Myrrhe in den Rauhnächten räuchert, sollte darauf achten, dass diese von hochwertiger Qualität und gesicherter Herkunft sind.
TEXT: Andrea Gabriel