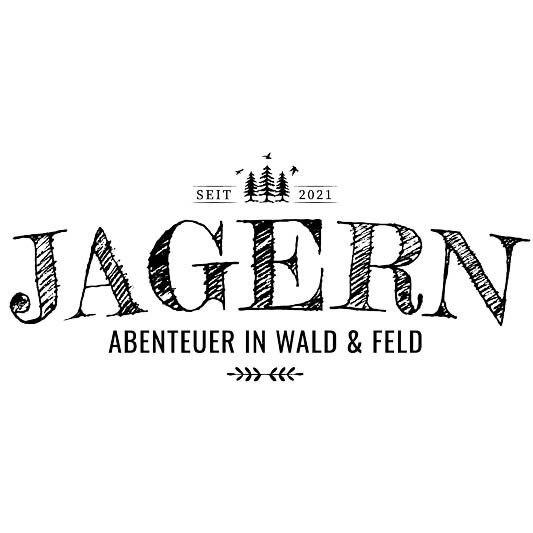„Fontainebleau! Wald, unermesslich und einsam!“
Diese ehrfurchtsvollen Worte sind die ersten des titelgebenden Protagonisten Don Carlo in der gleichnamigen Oper von Guiseppe Verdi aus dem Jahr 1867. Don Carlo spricht sie, als er seiner Liebe, Elisabeth von Valois, geheim in das Dickicht des Forêt de Fontainebleau, wie der Wald um das kleine Städtchen Fontainebleau im Französischen heißt, folgt.
Vor etwa zehn Jahren, am 13. August 2013, feierte diese Verdi-Oper bei den Salzburger Festspielen unter der Regie von Peter Stein ihre Premiere. Der erste Akt der imposanten Oper, deren Handlung eine Adaption des Dramas „Don Karlos, Infant von Spanien“ von Friedrich Schiller ist, spielt zur Zeit des Spanisch-Französischen Krieges, der im Jahr 1559 sein Ende fand. Im Gegensatz zu Schiller verlegte Verdi die Handlung des ersten Aktes in den Wald von Fontainebleau. So kam der mythische Wald, der etwa 55 Kilometer süd-östlich von Paris liegt, in das Herz der Salzburger Altstadt.
Warum Guiseppe Verdi die Handlung in den Wald von Fontainebleau verlegt, kann nicht abschließend geklärt werden. Naheliegend ist aber, dass der erste Akt in den ausgedehnten Wäldern Fontainebleaus, die im Herzen des Départements Seine-et-Marne liegen, spielt, da sich der italienische Komponist bewusst war, dass dieser Ortsname bei den Besuchern der Oper gewisse Bilder und Vorstellungen evoziert, die das Stück zwangsläufig subtil um eine politische Ebene erweiterten. Aber warum war davon auszugehen, dass den gebildeten Schichten West- und Mitteleuropas in der Mitte des 19. Jahrhunderts – spitz formuliert – ausgerechnet dieser Wald ein Begriff war?
Vom abgelegenen Kleinod zur Bühne der Weltpolitik
Die Erklärung dafür liegt nicht im Wald selbst, sondern in dem imposanten Schloss, welches mitten darin errichtet wurde: das Schloss Fontainebleau, zu Französisch Château de Fontainebleau. Zwar war das Schloss nie die Hauptresidenz der französischen Monarchen, das war seit den 1660er-Jahren das opulente Schloss Versailles, dennoch verbrachten Könige wie Ludwig XIV. mehre Monate pro Jahr, meist zur Sommerfrische, in Fontainebleau. Napoleon III., der Neffe Napoleon Bonapartes, welcher von 1852 bis 1870 Frankreich teils diktatorisch regierte, wurde in der Schlosskapelle von Fontainebleau getauft und dürfte den meisten Verdi-Hörern aus tagespolitischen Debatten bekannt gewesen sein. Aber alles der Reihe nach …
So wie sich das Schloss heute seinen Besuchern zeigt – und das sind im Jahr beinahe elf Millionen –, geht es auf Henri II. zurück. Dieser regierte von 1547 bis zu seinem Tod 1559 und ließ anstelle des alten Jagdschlosses, dessen Baugeschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, ein Schloss im Stil der damals aufkommenden Renaissance erbauen. Von außen erinnert heute freilich nichts mehr an den mittelalterlichen Donjon, der den Mittelpunkt von französischen Burgen des Mittelalters bildete. Henri II. und seine Ehefrau Caterina, die der einflussreichen Florentiner Familie der Medici entstammte, luden immer wieder Künstler aus Italien nach Fontainebleau ein, die mit der architektonischen Ausgestaltung des Schlosses und seiner unzähligen Räumlichkeiten beauftragt wurden. Die in dieser Zeit engagierten Künstler bildeten im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts die Schule von Fontainebleau, die eine sehr ausdifferenzierte Spielart des Manierismus darstellte. Das Mäzenatentum der französischen Monarchen schuf den fruchtbaren Boden für diese Stilrichtung, die sich von Fontainebleau aus bald in ganz Europa verbreitete.
Auch die auf Henri II. folgenden Monarchen hinterließen ihre Spuren in Fontainebleau und waren bemüht darum, dem Schloss jeweils eine eigene individuelle Note zu verleihen. Jedoch war es der Sonnenkönig Ludwig XIV., der Fontainebleau wohl am meisten prägte – nicht zwingend durch eine rege Bautätigkeit als vielmehr durch die intensive Nutzung und die dort verbrachte Zeit, welche die der vorangegangen Könige um ein Vielfaches überschritt. Zeitgenössische Quellen berichteten mit spitzer Zunge, dass man in Paris darüber aber gar nicht so unglücklich war, da so endlich Zeit und Anlass gegeben waren, das Schloss Versailles gründlich zu reinigen und wieder auf Vordermann zu bringen, bevor Ludwig XIV. mit seinem riesigen Hofstaat zurückkehrte.
Mit den ausgedehnten Aufenthalten des Monarchen kam auch zwangsläufig die „große Politik“ nach Fontainebleau. War man zuvor noch erpicht darauf, das politische Tagesgeschäft in Paris zu belassen, wurden unter Ludwig XIV. einige zentrale Ereignisse der französischen Geschichte von Fontainebleau aus dirigiert. Zu nennen wäre hier vor allem das Edikt von Fontainebleau von 1685. Ludwig nahm mit diesem die Toleranzpolitik seiner Vorgänger gegenüber den Protestanten zurück und machte den Katholizismus erneut zur Staatsreligion. Die Unterzeichnung des Ediktes zwang über eine Viertelmillion Hugenotten zur Flucht.
Fontainebleau als Jagdresidenz
Auch wenn im Lauf der Jahrhunderte das Schloss immer wieder zum Zentrum französischer Politik avancierte und weitreichende Entscheidungen hinter den alten Schlossmauern gefällt wurden, blieb Fontainebleau im Kern immer ein Jagdschloss. Und die dort residierenden Monarchen widmeten sich in Fontainebleau zuvorderst auch den schönen Dingen des Lebens: der Kunst, aber vor allem der Jagd.
Besonders Ludwig XIV. war es, der im Spätsommer mit dem ganzen Hofstaat nach Fontainebleau übersiedelte, um dort ausgiebig der Jagd zu frönen. Die bevorzugte Art der Jagd war damals die Parforcejagd, die zu Pferde ausgeübt wurde und dem Hochadel vorbehalten war. Die Weiten des Waldes, der das Schloss umgab, eigneten sich hervorragend für diese Art der Jagd.
Obwohl das äußert strenge Hofzeremoniell, das in Paris galt und den Tagesablauf nahezu minutiös strukturierte, in Fontainebleau gelockert wurde und man die Unbeschwertheit des Landlebens genoss, nutzen viele Höflinge die Gunst der Stunde, um in den engeren Kreis von Ludwig XIV. vorzustoßen und somit auch näher an das Zentrum der Macht zu rücken. Nur ausgesuchte Höflinge durften an den Jagden teilnehmen und Einladungen waren dementsprechend begehrt. Unterstrichen wurde die soziale Funktion der Jagdaufenthalte in Fontainebleau durch die unzähligen Bankette und Feste, welche die Jagdtage umrahmten. Auch internationale Gäste wie Zar Peter der Große (1672- 1725) fanden sich regelmäßig in Fontainebleau ein.
Beeindruckendes Zeugnis von diesen Jagdgesellschaften legt das Gemälde Vue du Château de Fontainebleau (zu Deutsch „Blick auf Fontainebleau“) ab. Das monumentale Bild mit den Maßen 2,4 x 2,9 Meter wurde in den Jahren 1718 bis 1723 vom französischen Künstler Pierre-Dennis Martin angefertigt und kann heute vor Ort bestaunt werden. Das Gemälde vermittelt dem Betrachter bis heute einen lebhaften Eindruck davon, wie die Jagd zur Zeit des Absolutismus zelebriert wurde.
Am unteren Rand des Bildes sieht man den adeligen Tross auf einer sachten Erhebung. Ludwig XIV., der drei Jahre vor der Anfertigung des Gemäldes starb, sitzt in einer prachtvollen Kutsche, die von unzähligen Männern zu Pferde umringt ist. Die Hunde, für die Parforcejagd zentral, sprengen vorneweg und führen den Zug an. Neben den Höflingen auf den Pferden sind auch noch weitere Menschen auszumachen, die zu Fuß der Jagd beiwohnen.
In den oberen zwei Dritteln des Gemäldes sieht man das Schloss Fontainebleau selbst, welches sich am Fuße des Hügels, auf dem Ludwig XIV. und seine Gefolgschaft reiten, liegt. Ins Auge fallen dabei sofort die großzügigen und streng geometrisch angelegten Barockgärten samt ihren Teichen, die das Schloss nach allen Richtungen hin umgeben. Der Ästhetik und Architektur des Schlosses kommt bei der Darstellung durch Martin wenig Beachtung zu. Viel mehr legt dieser den Fokus auf die schier endlosen Wälder, die Fontainebleau umgeben und sich auf dem Gemälde bis hin zum Horizont erstrecken.
Forêt de Fontainebleau
Der Wald selbst hat eine nicht minder wechselhafte Geschichte hinter sich – mit frühesten Besiedlungsspuren, die über 12.000 Jahre vor unsere Zeitrechnung zurückreichen. Lange Zeit aber siedelten Menschen nur an den Rändern des Waldes und es gab keine Versuche einer systematischen Erschließung. Erst als der der Wald um das Jahr 1050 in seiner Gänze in den Besitz des französischen Königshauses kam – davor war er im Streubesitz von kleineren Landadeligen – wurden nach und nach Wege angelegt. Zum einen natürlich, um den Königen und ihren Höfen das Abhalten von großen Jagdgesellschaften zu ermöglichen, aber auch für die Gewinnung der Rohstoffe Holz und Sandstein.
Das Schlagen des Holzes geschah während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ohne Rücksicht auf die Regeneration der Baumbestände und so schrumpfte der mächtige Wald von Fontainebleau zusehends. Um etwa 1650 waren nur noch rund 20 % der heutigen Fläche des Waldes – dieser erstreckte sich über knapp 25.000 Hektar – vorhanden. Erst im Laufe des folgenden Jahrhunderts fand ein Umdenken statt und unter der Ägide von Jean-Baptiste Colbert, der vor allem als Finanzminister von Ludwig XIV. Bekanntheit erlangte, fanden umfangreiche Aufforstungen statt, die dem Wald seine heutige Gestalt verleihen.
So ist es auch wenig verwunderlich, dass sich der Wald im nachrevolutionären Frankreich zu einem Sehnsuchtsort des Pariser Bürgertums entwickelte. Man war bemüht, die Natürlichkeit des Waldes zu bewahren und veranlasste bereits 1861, dass gewisse Teile des Waldes unter Schutz gestellt wurden. Der Forêt de Fontainebleau kann so als erstes intendiertes Naturschutzgebiet angesehen werden.
Diese Urwüchsigkeit übte eine starke Faszination auf zeitgenössische Künstler aus und es formierte sich in den 18030er-Jahren die „Schule von Barbizon“, benannt nach dem Örtchen Barbizon am Rande des Waldes. Der Wald selbst, aber auch die Lichtungen und die kleinen verstreuten Weiler samt der dort lebenden Menschen dienten Künstlern wie Théodore Rousseau oder Jean-François Millet als Sujets für ihre realistische Malerei. Später strömte auch die Künstlergeneration rund um Claude Monet, zentrale Figur des Impressionismus, nach Fontainebleau, um sich ausgiebigen Natur- und Lichtstudien zu widmen.
Heute ist der zweitgrößte Wald Frankreichs ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler aus dem nahen Paris, um zumindest für ein paar Stunden der Betriebsamkeit der europäischen Metropole zu entfliehen. Aber auch Sportler kommen voll auf ihre Kosten. Die Weiten des Waldes sind durch leicht befestigte Wege ausgezeichnet erschlossen und eignen sich deshalb bestens für Erkundungen zu Pferde. Die leichten Hügel, die den Wald durchziehen und an manchen Stellen als nackte Felsen an die Oberfläche treten, ziehen besonders Pariser Boulderer an, die hier ihre Kletterfertigkeiten trainieren.