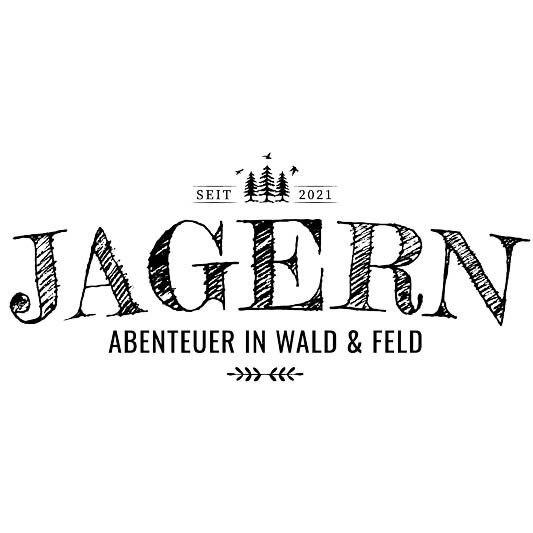Steinzeit: die Jäger, die in die Kälte kamen
Unter winterlichen Bedingungen zu jagen, ist wahrhaft kein junges Phänomen in der Menschheitsgeschichte. Immerhin besiedelten vor rund 45.000 Jahren die ersten Vertreter des Homo sapiens Europa während der vorläufig letzten Kälteperiode des Erdklimas. Diese nach einem Fundort in der südfranzösischen Dordogne benannten Cro-Magnon-Menschen passten sich an das im Vergleich zu heute 5 bis 13 Grad kältere Klima Europas an und stellten den durch die tundraartige Landschaft ziehenden Herden nach. Die Erfindung der Nadel lässt sich in dieser Hinsicht als wahrer Meilenstein ansehen, da das Nähwerkzeug die Herstellung gut isolierender Kleidung erlaubte. Praktischerweise lieferten die erlegten Tiere, die in der Größe vom riesigen Wollhaarmammut bis hin zum winzigen Fisch reichten, neben den dringend benötigten Kalorien auch gleich noch die Rohstoffe zur Bekleidungsherstellung. Pelze zählten also schon von Beginn an zu den wichtigsten Materialien der Haute Couture. Gut eingepackt war es den eiszeitlichen Jägern und Sammlern dann auch möglich, sich künstlerisch zu betätigen, wie die Höhlenmalereien von Lascaux oder Altamira und die ersten erhaltenen Musikinstrumente in Form von Knochenflöten beweisen.
Die Funde aus dieser Zeit lassen eine wesentliche Zunahme an persönlichem Schmuck erkennen, was wiederum auf eine gewisse gesellschaftliche Ausdifferenzierung hinweisen könnte. Nicht zu vergessen sind in diesem Kontext auch kleinere Kunstgegenstände wie die Figuren nach dem Typ der berühmten Venus von Willendorf, deren Schöpfer sich beim Schnitzen vielleicht in einen (selbsterlegten) Pelz hüllte. Vor ca. 12.000 Jahren begann eine nachhaltige Klimaerwärmung, welche in der Wissenschaft als Anfangspunkt des gegenwärtigen Erdzeitalters (Holozän) betrachtet wird. Mit den klimatischen Veränderungen wandelte sich ebenso das Bild der europäischen Landschaft von den zahlreichen Kältesteppen hin zu dichten Waldgebieten, wodurch die großen Herden an Rentieren, Wildpferden und anderen Pflanzenfressern verschwanden. In der Folge kam es anscheinend zu einem massiven Bevölkerungseinbruch in weiten Teilen des Kontinents, da unseren Vorgängern das Verschwinden der an die winterlichen Bedingungen angepassten Nahrungsressourcen schwer zu schaffen machte. Bis zur Etablierung von Ackerbau treibenden Gesellschaften in der Jungsteinzeit sollten die meisten Gegenden Europas dann auch nur sehr dünn besiedelt bleiben.
Mittelalter: Mode mit Aussagekraft
Mit der Sesshaftigkeit mochte zwar das Leben eines Großteils der Menschheit stetiger geworden sein, das globale Wetter blieb aber seinem konstanten Wechsel über die Jahrhunderte unterworfen. Jene klimatischen Schwankungen wirkten sich natürlich auf die Landwirtschaft sowie die Viehzucht und somit die Lebensgrundlage aller Völkerschaften aus, wobei sich die Wärmephasen als günstig für das Gedeihen der Ernte erwiesen. Es verwundert daher nicht, dass es im mittelalterlichen Klimaoptimum ungefähr zwischen 900 und 1400 n. Chr. zu einem massiven Bevölkerungswachstum in Europa kam.
Nichtsdestoweniger konnte es einem in der Winterzeit nach wie vor schon noch empfindlich kalt werden, wogegen am besten das Einhüllen in dicke Pelze half. Freilich mussten sich Fröstelnde das erst einmal leisten können, weshalb die Bälge von Fuchs, Marder und Konsorten meist der adligen Oberschicht vorbehalten blieben. Das hohe soziale Prestige der haarigen Tracht wird unter anderem daran deutlich, dass sich nur höchste Würdenträger wie Kaiser, Könige und Päpste mit den als besonders wertvoll erachteten Hermelinfellen schmücken durften. (Pelz-)Kleidung konnte aufgrund ihrer hohen sozialen und wirtschaftlichen Aussagekraft auch als eine Art Bonus für gute Dienste oder Gunstbeweis dienen. Walther von der Vogelweide, seines Zeichens einflussreichster Dichter deutschsprachiger Lyrik des Mittelalters, bekam etwa vom Passauer Bischof Wolfger im November 1203 einen Pelzmantel geschenkt, wie aus einer erhaltenen Abrechnung hervorgeht. Diese im wahrsten Sinne des Wortes warmherzige Belohnung könnte sich Walther durch seine künstlerischen Fähigkeiten oder aber in einer diplomatischen Funktion erworben haben, für die er als herumreisender Minnesänger ja prädestiniert war. Dass Wolfger zur selben Zeit ähnlich stattliche Summen für die neuen Mäntel von höheren Klerikern aus seinem direkten Umfeld ausgab, lässt Rückschlüsse auf die Bedeutung des Dichters am Passauer Hof zu. Übrigens beteiligte sich der zahlungskräftige Gönner Walthers nicht nur an den Lösegeldverhandlungen für den inhaftierten Richard Löwenherz und an der Errichtung des Deutschen Ordens, sondern wirkte nebenbei wahrscheinlich auch noch als Mäzen des unbekannt gebliebenen Verfassers des Nibelungenlieds.
Renaissance: der Teufel steckt im Detail
In der ständischen Gesellschaft des Mittelalters und der Frühen Neuzeit kam Kleidung im Allgemeinen und Pelzen im Speziellen durchgehend eine wichtige repräsentative Rolle zu, da sie die Position ihres Trägers in der sozialen Hierarchie signalisierten. Aus diesem Grund bestanden in manchen Gegenden bis ins 19. Jahrhundert hinein strenge Kleiderordnungen, von denen nur Gruppen mit besonderem Status, meist eben infolge bedeutender Funktionen oder Leistungen, ausgenommen waren. Aus diesem Grund trugen beispielsweise die Landsknechte des 16. Jahrhunderts so ausgefallene Monturen, da sie so ihre Privilegien als von den Mächtigen gleichermaßen geschätzte wie gefürchtete Söldnerverbände jedermann vor Augen führen konnten. In jener Zeit, genauer gesagt um 1565, entstand das wohl berühmteste Gemälde zum Thema Winterjagd: Die Jäger im Schnee von Pieter Bruegel dem Älteren. „Bauernbruegel“ zeigt darauf die Rückkehr von drei mit Spießen bewaffneten Weidleuten samt Hundemeute in ein winterliches flandrisches Dorf. Riesig viel Beute scheint der Jagdausflug in die Kälte nicht gebracht zu haben, da die Gruppe nur einen Fuchs mit sich führt. In für ihn typischer Manier hält der niederländische Meister zahlreiche Details des ländlichen Alltags seiner Zeit fest. Dem genauen Betrachter offenbaren sich etwa Schlittschuhläufer auf zugefrorenen Deichen, ein Kaminbrand oder Vorbereitungen für das Sengen eines geschlachteten Schweins. Damit ist jedoch noch lange nicht Schluss, denn das scharfe Weidmannsauge vermag noch viel mehr zu erspähen: Eine damals beim einfachen Volk beliebte Vogelfalle, die aus einer alten Tür zusammengezimmert scheint, findet sich in der Bildmitte. Aufmerksame Leser vergangener Ausgaben werden sich daran erinnern, dass der Vogelfang damals eine der wenigen Jagdformen war, die dem einfachen Volk offenstanden. Das schief an dem Gasthaus am linken Rand des Gemäldes hängende Schild zeigt eine Darstellung der Bekehrung des heiligen Eustachius durch sein Erlebnis mit dem Hirsch, der ein Kreuz zwischen seinen Geweihstangen trägt. In der Nähe der rechten oberen Ecke findet sich sogar ein winzig kleiner Jäger, der mit seiner Arkebuse gerade auf Wasservögel feuert.
Wer wirklich ganz genau hinschaut, vermag sogar die aus der Mündung des Vorderladers schlagenden Flammen zu erkennen. Dieses Detail stellt somit eine sehr frühe Darstellung der Verwendung von Feuerwaffen bei der Jagd dar. Hierbei stellt sich die Frage, ob der Künstler eine verbreitete Praxis darstellt oder nur eine spannende, aber realitätsferne Kleinigkeit hinzufügen wollte. Den Beinamen „de Drol“ („der Drollige“) werden Bruegels Zeitgenossen ihm ja nicht völlig umsonst verliehen haben. Das Kunstwerk entstand jedenfalls als Teil einer Serie von insgesamt sechs Bildern, die den Verlauf der Jahreszeiten repräsentieren. Keine Sorge, ihr habt euch gerade nicht verlesen, denn Bruegel malte tatsächlich sechs, da damals auch Vorfrühling und Vorsommer als eigene Saison betrachtet wurden. Bei dem Gemälde handelt es sich um die erste bekannte großformatige Darstellung von Schnee in Europa und nach Expertenmeinung dient es als die Jahreszeitenreihe abschließende Versinnbildlichung des Winters. Daher kann Die Jäger im Schnee nicht nur als herausragendes Kunstwerk, sondern auch als Ausdruck der Mentalität unserer Vorfahren am Beginn der Neuzeit gesehen werden. Für diese scheint die (Fuchs-)Jagd ein fester Bestandteil winterlicher Aktivitäten gewesen zu sein. Zusätzlich wird das Gemälde im wissenschaftlichen Kontext auch oft zur Illustration der „Kleinen Eiszeit“ herangezogen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Periode der klimatischen Abkühlung ungefähr zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert, welche nicht nur den Weidmännern ihr Handwerk schwieriger machte, sondern auch für Ernteeinbrüche sorgte und Unruhen befeuerte.
Winterjagd: ein Lebensstil mit modernen Tücken
In Russland erfüllte die aus dem Winterfell des Zobels gefertigte „Mütze des Monomach“ über Jahrhunderte hinweg die Funktion einer Herrscherkrone, und die Beamten des Zaren erhoben eine eigene Steuer auf Zobelpelze, welche ihm die besten Exemplare der Jagdbeute seiner Untertanen sichern sollte. Dieser „Jassak“ wurde auch von den nomadischen Stämmen Sibiriens eingehoben und die so erworbenen Kronenzobel dienten den russischen Herrschern gleichermaßen als finanzielle Reserve und diplomatisches Kapital für Geschenke an andere gekrönte Häupter. Die zur Eintreibung des Tributs abgestellten Kosaken gingen ganz ihrer Art gemäß meist wenig zimperlich vor und schon so mancher Jäger soll vorher selbst zu Säbel oder Beil gegriffen haben, ehe er allzu viele seiner Felle Richtung Moskau davonschwimmen sah. Das also durchaus gefährliche Geschäft mit der Winterjagd war eine rentable Sache, zumindest für die Oberschicht. Neben der englischen Königin Elisabeth I. erhielten beispielsweise die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Zobelbälge. An Rudolf II. von Habsburg sollen 1594 sogar über 40.000 Felle aus der Schatzkammer des Kreml geliefert worden sein, um ihm bei dem geplanten Krieg gegen die Türken finanziell unter die Arme zu greifen. Selbst die Machtübernahme der Kommunisten vermochte dieser Tradition nicht den Garaus zu machen, da etwa Elisabeth II. oder die persische Kaiserin Soraya gleichermaßen warm beschenkt wurden. Vielleicht wollte man so den Ruf eiskalter Apparatschiks im Ausland aufpolieren? Heute würde eine solche PR-Strategie jedenfalls ziemlich sicher nach hinten losgehen, denn zumindest in der westlichen Hemisphäre steht Pelz dank zahlreicher Kampagnen, die seit den Sechzigern von Tierschützern gefahren werden, nunmehr in starkem Misskredit. Bei manchen geht die Abneigung sogar so weit, dass sie selbst zur Waffe greifen: In den Niederlanden wurde der Politiker und Pelzbefürworter Pim Fortuyn 2002 von einem radikalen Tierschützer erschossen, was dem kleinen Land auf internationaler wie innenpolitischer Bühne viel von seiner Bruegel-Drolligkeit nahm. Die Mehrzahl der Anti-Pelz-Aktivisten schaffte es aber selbst ohne Waffen, einiges an Schaden anzurichten.
Ein besonderer Dorn im Auge war Leuten wie Brigitte Bardot dabei die Jagd auf Robben, was in vielen Ländern schließlich zu Einfuhrverboten und ähnlich strengen Regelungen führte. Infolge der vielen Initiativen kam es zu einem massiven Einbruch des Handels mit Robbenfellen und anderen Wildtierhäuten, was weitreichende soziale Folgen bis in unsere Tage zeitigte. Für die Inuit Grönlands und Nordostkanadas beispielsweise stellt nämlich die Jagd auf Robben nicht nur einen elementaren Bestandteil ihrer traditionellen Lebensweise und ein Fundament ihrer Ernährung dar, sondern versorgte die in kargster Wildnis weit abseits moderner Infrastruktur gelegenen Gemeinden mit bitter benötigten finanziellen Mitteln. Der Tourismus könnte zwar einen Teil dieser Einkünfte ersetzen, doch wagen sich auch nach längeren Werbeanstrengungen nur wenige hartgesottene Urlauber in die eisigen Polarregionen. Am Beispiel des mit Dänemark assoziierten Grönlands wird die volle Tragweite der Misere deutlich. Dort konnten Maßnahmen der staatlichen Sozialhilfe einen gewissen Ausgleich für die materiellen Schäden des Pelzboykotts bieten. Was sich aber mit keinem Geld der Welt kompensieren lässt, ist die Zerstörung einer überlieferten Wirtschafts- und Lebensweise, welche den Menschen in der Region seit Anbeginn ihrer Kultur Sinn und Gemeinschaft gestiftet hat. Ohne die ihnen traditionell zukommende Beschäftigung bei der Jagd sind viele Grönländer quasi arbeitslos, was die Anzahl der Fälle an Alkoholismus und/oder Depressionen vervielfachte. Eine breite mediale Rezeption dieses Problems blieb bisher aber aus.
Winterjagd scheint schon seit Urzeiten ein Phänomen besonderer Extreme gewesen zu sein. So stellen die niedrigen Temperaturen und Schneestürme die Jäger seit Jahrtausenden immer wieder auf harte Proben. Die durch moderne Kleidung und Ausrüstung geschaffene Erleichterung bei den Strapazen erscheint rückblickend durch gewisse Nachteile auf gesellschaftlicher Ebene erkauft. Bruegels Jäger müssen sich jedenfalls gewiss nicht für ihr Tun rechtfertigen, wenn sie nach mehr als 400 Jahren des Schneestapfens vielleicht doch einmal nach Hause kommen sollten. Bei dem Gedanken an die lange Zeit mit ihren vielen Veränderungen kann einem ganz schwummrig und kalt werden. Gut nur, dass wir selbst nach der längsten Jagd viel schneller wieder in die heimatliche Wärme der eigenen Wohnstatt kommen, an der alle Stürme der Zeit vorbeizuziehen scheinen. Und wer weiß, vielleicht erwartet einen dort das eine oder andere Weihnachtsgeschenk.