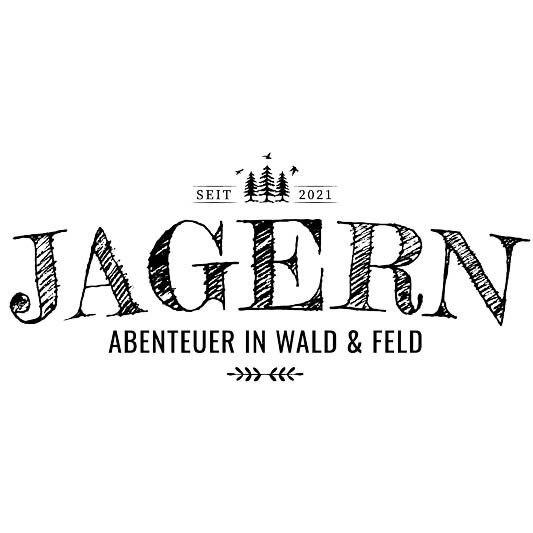Seit gut zehn Jahren sieht man sie wieder überall, die flauschigen Krägen, Haubenbommel und Taschenanhänger en nature oder knallig bunt gefärbt. Webpelz? Auch, aber nicht nur! Mancher fragt sich nun, ob Pelz wieder salonfähig geworden ist und ob es sich vielleicht lohnen würde, seine Winterfüchse gerben zu lassen. Wir haben eine kleine Marktbeschau gemacht und Frustrierendes festgestellt.
2020 endete die bekannte PETA-Kampagne „Lieber nackt als im Pelz“, für die sich 30 Jahre lang Prominente mehr oder weniger einprägsam hüllenlos ablichten ließen, um auf die Missstände der Pelztierzucht aufmerksam zu machen. Mit einem gewissen Erfolg: So sind mittlerweile in einigen europäischen Ländern Pelztierfarmen verboten – etwa in Österreich, Luxemburg, Großbritannien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzigowina, Serbien, Mazedonien und jährlich kommen neue Länder dazu. Auch die Covid-19-Pandemie, in der Millionen dänischer Nerze gekeult wurden und somit die Nerzzucht in Dänemark vor das Aus gestellt hat, scheint ein gewisser Katalysator für die Abkehr vom Pelz zu sein. Israel prescht gar als erstes Land der Welt mit einem kompletten Handelsverbot für Pelze zu modischen Zwecken ab Ende 2021 vor.
Dennoch stammen rund 85 % der weltweit gehandelten Pelze aus der Zucht, wobei China mit einem Marktanteil von etwa 50 % den Handel dominiert. Wer aber einmal gesehen hat, wie es in den dortigen Pelztierfarmen zugeht, braucht ein strapazierfähiges Gewissen, um sich willentlich einen solchen Pelz anzulegen. Das Heimtückische daran: meist erhält man nur beim traditionellen Kürschnerbetrieb Auskunft, woher der verwendete Pelz wirklich stammt. Und obwohl die traditionellen Betriebe immer weniger werden – in Österreich etwa finden sich keine 100 Kürschner mehr – hat sich der Umsatz der Pelzbranche in der EU zwischen 2005 und 2015 verdoppelt – der Großteil des Pelzumsatzes läuft also über die großen Modeketten, die nur selten über die genaue Herkunft der Pelze Auskunft geben können. Weiters heikel: deklarationspflichtig ist ein Pelzbesatz nur, wenn der restliche Artikel zu 80 % aus Textilmaterial besteht, womit etwa auch Leder-waren wie Schuhe davon aus-genommen sind. Verbrauchertests zeigten in den letzten Jahren, dass selbst Waren, die als Kunstpelz gekennzeichnet waren, eigentlich echte Pelze enthielten. Der Grund? Asiatischer Zuchtpelz ist bei gleicher Qualität billiger herzustellen als Webpelz. So weit so frustrierend. Wie sieht es aber nun mit in heimischer Jagd erlegten Tieren wie dem Rotfuchs aus? Im Sinne der Nachhaltigkeit und dem Respekt dem geschossenen Tier gegenüber, sollte man doch so viel von ihm verwerten wie nur möglich.
Zu Beginn letzten Jahres musste man lesen, dass in der Schweiz der Preis für heimische Fuchsfelle so tief gefallen waren, wie seit 1950 nicht mehr. Damals kostete ein Fuchsbalg zwei Franken, im Jahr 2020 war man ungeachtet jeglicher Inflation bei 5 Franken angelangt, nachdem sich die Prei-se in den 2010er-Jahren kurzfristig etwas erholt hatten.
Dabei war man aber noch weit von einstigen Höhen entfernt geblieben. So erhielt 1980 der Jäger zwischen 70 und 80 Franken pro Pelz, was eine ähnlich hohe Summe wie in den 1930ern war, in denen bis zu 100 Franken erzielt werden konnten. Diese Preisentwicklung wird umso unverständlicher, wenn man sich die Schweizer Import-zahlen ansieht: 2016 waren dies 463 Tonnen Pelzfelle – so viele wie seit den späten 1990er-Jah-ren nicht mehr. Und doch: der Schweizer Fuchs ist unbeliebt. Auch wenn vereinzelte Initiativen wie Royal Fox of Switzerland das zu ändern versuchen. Das junge Label verwendet nur Fuchspelze aus fallenfreier Schweizer Jagd für den Besatz ihrer Jacken und Hauben. Ähnliches versuchte man auch in Deutschland. 2017 wurde mit Unterstützung der Landesjagd-verbände die Fellwechsel GmbH gegründet, die sich zum Ziel machte, Felle aus heimischer Jagd auf den Pelzmarkt zu bringen. Statt Fuchs, Nutria und Bisam in der Tierkörperverwertung zu entsorgen, hätte der einsendende Jäger sogar eine kleine Entschädigung bekommen sollen, was für die genannten Tiere aber bereits in der Saison 2019/2020 wieder eingestellt wurde: unrentabel sei es geworden, konnte man in den Medien lesen. Mittler-weile scheint das Projekt gänzlich gescheitert.
Auch die österreichischen Kürschner bemühen sich etwa mittels des „Red Fox Awards“ wieder um die Salonfähigmachung jagdlich gewonnener Fuchsfelle und heimische Gerbereien machen sich Gedanken, wie man die Konservierung von Pelzen umweltfreundlich gestalten kann. Vegetabil und schadstofffrei gerbt etwa die Gerberei in Mönchmeierhof (www.bioleder.at). Auch die Gerberei Holubovsky (www.felle.at) bietet die schadstoffarme Weißgerbung für Fuchsfelle an. Es mag zwar auf dem internationalen Pelzmarkt nur mehr wenig Platz für den heimischen Fuchs geben, aber das muss den Raubwildjäger nicht weiter kümmern – wegen dem Pelz jagt er sowieso schon lange keinen Fuchs mehr. Aber warum sich nicht selbst oder seinen Liebsten ein Geschenk machen und die schönsten Winterfüchse kürschnerisch verarbeiten lassen? Vom Sofakissen, über Haube, Muff und Schal, bis hin zur warmen Decke setzt der Kreativität höchstens der Geldbeutel eine Grenze.
TEXT: Eva Weiler