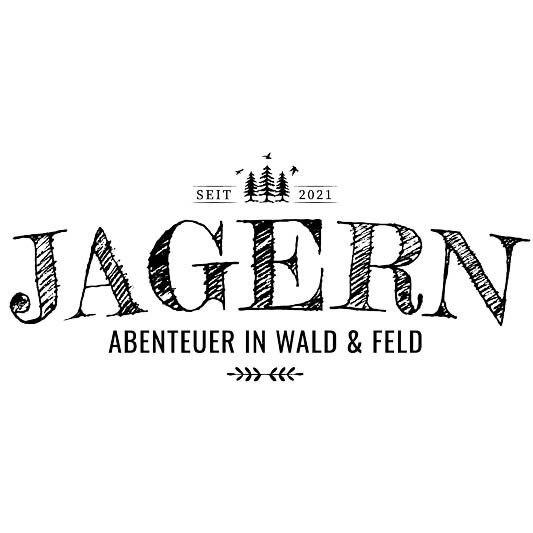In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Innovationsexplosion auf dem waffentechnischen Markt. Eine der größten Veränderungen war sicherlich der Übergang von Vorderlader zu Hinterlader, der in der österreichischen Monarchie vor allem durch die schmachvolle Niederlage in der Schlacht bei Königgrätz beflügelt wurde. Dort standen sich die Preußen 1866 mit ihren neuartigen Zündnadelgewehren und die Österreicher und Sachsen mit ihren traditionellen Vorderladern gegenüber. Es zeigten sich trotz aller Nachteile der neuen Gewehre – Trefferleistung und Reichweite waren vermindert, der Verschluss ging schwer und durch die komplizierte Herstellung der Einheitspatrone war diese recht fehleranfällig – die Mängel der Vorderlader.

Besonders die Notwendigkeit beim Laden aufzustehen und die Ladung mittels Ladestock in den Lauf zu stoßen, bot dem Feind eine erweiterte Angriffsfläche und führte zu langen Ladezeiten zwischen zwei Schüssen. Die Hinterladerschützen hingegen konnten beim Laden liegen bleiben und sich der neue Taktik des „Schnellschusses“ bedienen, bei dem sie so schnell wie möglich hintereinander feuerten. So wurde Königgrätz nicht nur richtungsweisend für die weitere Geschichte Zentraleuropas – durch den Sieg wurde Preußen Führungsmacht in Deutschland und Otto von Bismarck setzte infolgedessen die kleindeutsche Lösung durch –, sondern auch für die weitere Entwicklung der Langwaffen für Gefecht und Jagd.

So gab es schon 1901 eine kleine Sensation aus Steyr zu vermelden: die erste Flinte, bei der Läufe und Gehäuse aus einem Stück Stahl gefertigt wurden, ging in Produktion. Wer sie entwarf und wie sie genau gefertigt wurde, darüber schweigen die Quellen der Steyr Arms GmbH, die als Nachfolgefirma der ÖWG und verschiedener Zwischenstufen, wie viele andere auch, eine durch zwei Weltkriege bedingte Einbuße an historischen Unterlagen beklagen musste. Ende des ersten Weltkriegs wurde die Monoblockflinte, die eine in kleiner Auflage produzierte, teure Waffe für den (Geld-) Adel war, eingestellt. Gut hundert Jahre danach, gibt es aber wieder einen Monoblock aus Steyr – ganz anders und doch basierend auf der Innovation aus dem Jahr 1901. Wir durften mit Harald Pichler, dem Entwickler dieses neuen Monoblocs sprechen.
Was unterscheidet deinen modernen Monobloc vom historischen Vorbild?
Der historische Monoblock war eine Flinte, meine Entwicklung ist ein Präzisionsrepetierer. D. h. früher hatte man zwei Läufe, die nebeneinanderliegend Schrotladungen auf ein gemeinsames Ziel lenken mussten. Heute liegt die Kunst darin, Lauf, Patronenlager und Gehäuse aus einem Teil zu schmieden. Auch ist bei einem Repetierer die Innengestaltung des Laufs ganz anders. Wir haben heute ein gehämmertes Zug-Feldprofil drinnen, der historische Monoblock hatte glatte Läufe. Eigentlich ist nur die Fertigung in einem Stück die zentrale Ähnlichkeit. Alles andere haben wir neu entwickelt.
Wie bist du auf die Idee gekommen, den historischen Monoblock neu zu interpretieren?
Daran ist einer unserer Verkäufer schuld. Der hat einmal gesagt, „wir bräuchten wieder einmal so einen Hammer wie den Monoblock“ – also etwas, das sonst niemand hat. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe mir dann beim Jagern überlegt, ob man diese Monoblockfertigungsweise nicht auch für ein modernes Jagdgewehr nutzen könnte und schon war die Idee geboren.
Was ist der Vorteil davon, wenn Lauf und Gehäuse nur aus einem Teil bestehen?
Der Riesenvorteil daran ist ja, dass man sich das Gewinde sparen und so ein schlankes Gehäuse bei höherer Stabilität machen kann, aber auch dass er weniger fehleranfällig ist. Man kennt das ja: Je mehr Teile man hat, desto mehr Abweichungen und Fehler können passieren. Wenn ich aber zwei unterschiedliche Monobloc-Kaliber nehme und sie nacheinander in denselben Schaft einspanne, dann habe ich trotzdem nur minimale Abweichungen. Das war auch eine der großen Herausforderungen bei der Entwicklung, den Monobloc so zu bauen, dass er ein modulares Gewehr wird.
Interview: Harald Pichler, Eva Weiler
Fotos: Harald Pichler, Steyr Arms