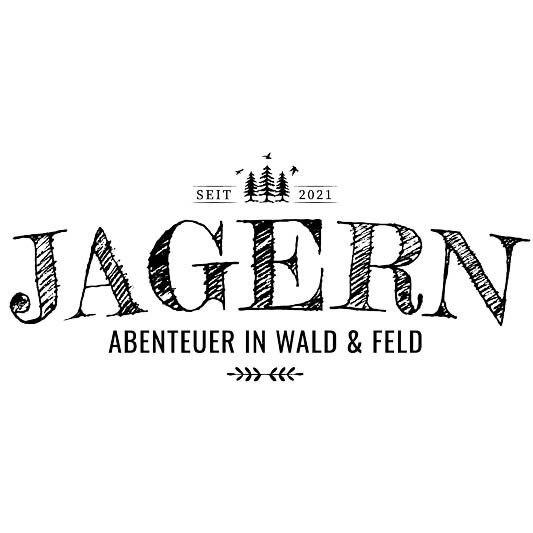Alles Schall und Rauch! – Die Physik des Lärms
Ehe wir uns mit Details beschäftigen können, gilt es, noch eine viel grundsätzlichere Frage zu klären: Wie funktioniert so ein Ding denn überhaupt? Um hier eine Antwort zu finden, müssen wir noch einen weiteren Schritt zurück tun und uns genauer anschauen, wie sich die Sache mit dem Schall verhält. Was so einfach erscheint, ist nämlich – manch einer wird es schon erraten haben – bei genauerer Betrachtung durchaus kompliziert. Das uns wohlbekannte Krachen des Schusses kommt, genauso wie alle anderen Knallgeräusche, durch eine schlagartige Veränderung des Luftdrucks zustande. In der Umgebungsluft des feuernden Schützen breitet sich der durch die gezündete Treibladung des Projektils hervorgerufene Druck wellenförmig nach allen Seiten hin aus. Dem menschlichen Ohr präsentiert sich das Produkt dieses Vorgangs als ein einziges Geräusch, doch wirken hier in Wahrheit mehrere Lärmquellen zusammen. So passen sich die hochkomprimierten Verbrennungsgase beim Verlassen des Laufs an den Umgebungsdruck an und erzeugen auf diese Weise den Mündungsknall. Das aus dem Jagdgewehr hinausgeschleuderte Geschoss wiederum verdrängt mit seinen 700 bis 900 Metern pro Sekunde die vor ihm liegende Luft mit derartiger Wucht, dass sich hinter ihm eigene Schallwellen kegelförmig ausbreiten. Der Schalldämpfer reduziert den Mündungsknall, indem er auf das austretende Gas einwirkt, weshalb er an dem erst an späterer Stelle zustande kommenden Geschossknall nichts zu ändern vermag.
Ein auf besondere Ruhe bedachter Schütze muss deshalb auf eigene, schwächer geladene Munition ausweichen, bei der das Projektil nicht die magische Geschwindigkeitsgrenze zwischen 320 und 350 Metern pro Sekunde überschreitet. Erst bei der gemeinsamen Verwendung von Schalldämpfvorrichtungen und Unterschallmunition werden die ansonsten überlagerten Geräuschquellen bei der Schussabgabe in der Regel wahrnehmbar. Zu nennen wären hier die Abzugs- und Nachlademechanik, das Fluggeräusch des Projektils, der sich im Waffenkörper selbst fortpflanzende Schall sowie der Kugelschlag. Je nach den Gegebenheiten können diese Nebenaspekte des gedämpften Schusses mehr oder weniger vernehmbar werden, weswegen im militärischen Bereich beispielsweise schon der automatische Mechanismus von Selbstladepistolen absichtlich blockiert wurde. Wer mit herkömmlicher Munition jagen möchte und trotzdem Wert auf einen möglichst geringen Schusslärm legt, sollte sich an die Faustregel halten, dass der Knall umso geringer ausfällt, je kleiner Kaliber und Hülsenvolumen der genutzten Waffe sind. Diese zugegeben recht offensichtliche Bemerkung lässt sich noch durch einen spezielleren Tipp ergänzen: Das Benetzen des Dämpferinneren mit Wasser, Öl oder Gleitgel wirkt sich positiv auf dessen akustisches Regulierungsvermögen aus. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da durch den Gasrückstrom bei Selbstladern Material aus dem Dämpfer ins Waffeninnere getragen werden kann. Wasser kann bekannterweise bei Stahlelementen zu Rost führen, während Öl der Ablagerung von Schmauch an den Wänden des Dämpfers entgegenwirkt.
Viele Wege, ein Ziel – Funktionsweisen
Alles schön und gut, doch was geschieht denn nun tatsächlich in dem kleinen Extrarohr vor der Mündung? Kurz gesagt, geht es stets um Verzögerung. Sozusagen müssen sich die rabiaten Verbrennungsgase nach getaner Arbeit erst einmal etwas abreagieren, ehe man sie in die Umwelt entlässt. Welch anspruchsvolles Unterfangen dies darstellt, macht ein Blick auf die Volumenverhältnisse deutlich: Unter gewöhnlichen Bedingungen wird nämlich ein Liter Gas pro verbranntem Gramm Nitrocellulose-Schießpulver erzeugt. Infolge des geringen Platzangebots kommt es somit zum Aufbau eines immensen Drucks, welcher auf seinem Weg nach draußen das Geschoss beschleunigt und dann durch das Zusammentreffen mit der wesentlich weniger verdichteten Atmosphäre außerhalb des Laufs einen lauten Knall zeitigt.
Außer man hat eben einen Dämpfer aufgeschraubt, denn dieser reguliert den Treibgasdruck im Gefolge des Projektils durch mehrerlei Mechanismen herunter. Als Erstes bietet ein Schalldämpfer den komprimierten Gasen einen zu den Seiten hin abgeschlossenen Raum, um sich etwas auszudehnen. Auf diese Weise wird der Faktor Volumen in der sogenannten „allgemeinen Gasgleichung“ reduziert, was in einer Entspannung des Drucks resultiert. Das Ganze lässt sich mit einem Luftballon vergleichen: Wenn die Gummihülle durchstoßen wird, dringt die unter Druck stehende Luft plötzlich auf einen Schlag heraus und verursacht einen Knall. Wenn die Füllung den Ballon allerdings langsam über die Aufblasöffnung verlassen kann, kommt es nur zu einem sachten Pfeifen. Des Weiteren spielt die Temperatur des Treibgases eine erhebliche Rolle, da Abkühlung ebenso mit Druckreduktion verbunden ist. Zahlreiche Hersteller beschichten das Innere ihrer Dämpfvorrichtungen daher mit Stoffen, die Wärme schnell weiterleiten, wobei auf möglichst viel Fläche für den Temperaturtausch geachtet wird. Wie sich die verschiedenen Wirkprinzipien gegenseitig ergänzen, wird daran deutlich, dass die innenliegenden Lamellen nicht nur der Oberflächenvergrößerung dienen, sondern als Hindernisse auch zu einer Verwirbelung des Gasstroms führen.
Ähnlich wie bei Buhnen und anderen Dammbauten im Wasser wird der anbrandende Gasstrom gebrochen und sein Fortkommen durch Gegenströmungen verzögert. Wer es aber übertreibt und zu viele innenliegende Blenden anbringt, reduziert die Dämpfwirkung jedoch wieder, da so das für die Gasausdehnung zur Verfügung stehende Volumen verringert wird. Hierin liegt auch ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Herstellung begründet, da auf dem Reißbrett entwickelte Blendenanordnungen erst mittels intensiver praktischer Erprobungen Serienreife erlangen.
Weiters kann ein Schalldämpfer Einfluss auf die Frequenz des Schießgeräusches ausüben, welche sich wiederum auf die Hörbarkeit des Mündungsknalls auswirkt. Diesem auch bei der Hundepfeife angewandten Prinzip folgend, wurde in den 1950er-Jahren der nach seinem Erfinder benannte Jarrett-Schalldämpfer entwickelt. Auf dem Papier hätte dieser spezielle Vorsatz den Knall der Waffe in den für menschliche Ohren nicht wahrnehmbaren Ultraschallbereich verschieben sollen, vermochte sich jedoch in der Praxis aufgrund mangelhafter Leistungen nicht zu bewähren. Die Frequenz eines Feuerwaffenknalls ist von vielerlei Faktoren wie Laborierung, Bauweise oder Umwelteinflüssen abhängig und lässt sich daher nur schwer gezielt regulieren, wobei die Erfahrung zeigt, dass großräumigere Vorrichtungen eher für dumpfere Geräusche sorgen.
Zu guter Letzt entsteht durch den Aufprall der Verbrennungsgase aus dem Lauf im Schalldämpfer etwas Lärm, wogegen manche Modelle mit feuerfestem Material ausgepolstert oder mit doppelter Umwandung versehen werden. Außenhüllen ändern zwar nichts an dem so entstehenden Schalldruck, könnten sich aber günstig auf dessen Frequenz auswirken und den Ton etwas abdämpfen. Mit Sicherheit verhindern Neopren- oder Nomexmanschetten jedoch Reflexionen, Hitzeschlieren und metallische Klickgeräusche beim versehentlichen Anstoßen an Elementen der Umgebung. Die Mehrzahl der Dämpfer macht sich eine Kombination der gerade geschilderten Wirkungsprinzipien zunutze.
Ein jeder nach seiner Façon – Material und Form
Die meisten Schalldämpfer bestehen, von speziellen Legierungen einmal abgesehen, entweder aus Stahl, Aluminium oder Titan, wobei jeder Werkstoff seine speziellen Vorzüge und Nachteile hat. Stahl ist der Klassiker unter den Werkstoffen schlechthin, da er schon lange von der Industrie genutzt wird und über eine hohe Lebensdauer verfügt – die Vermeidung von Rost durch gute Wartung vorausgesetzt. Zusätzlich hält ein stählerner Dämpfer selbst extreme Hitzebelastungen aus und leitet Wärme gut ab. Erkauft werden diese Vorteile durch das vergleichsweise hohe Gewicht von ungefähr einem halben Kilogramm, welches den Schwerpunkt der Waffe zwar ungünstig beeinflusst, dafür aber beim Abfangen des Rückstoßes hilft. Aluminium hingegen ist um einiges leichter, dafür aber auch empfindlicher, denn die kritische Temperaturgrenze liegt hier bei 200 Grad Celsius. Daher geht der gewöhnliche Verschleiß also deutlich schneller vonstatten. Titan wiederum vereint Leichtigkeit mit hoher Hitzefestigkeit und sorgt durch seine speziellen Eigenschaften für deutlich weniger Schmauchablagerungen. Als Mankos lassen sich der relativ hohe Preis sowie die geringere Wärmeleitfähigkeit des Metalls anführen.
Die Lebensdauer von Schalldämpfern wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wobei eben Stahl deutlich länger durchhält als Aluminium. In der Literatur finden sich Angaben von mehreren tausend Schuss, die einen stählernen Dämpfer erst langsam an sein Lebensende kommen lassen, während es bei Leichtmetallgeräten nur viele hundert bis ein paar tausend braucht, um sie reif für den Altmetallcontainer zu machen. Für weidmännische Belange spielen diese Grenzen weniger eine Rolle, da im Revier weitaus seltener ein Projektil durch den Dämpfer gejagt wird als am Schießstand. Dort allerdings sollten vor allem Nutzer von Halbautomaten bedenken, dass Serien von schnell nacheinander abgegebenen Schüssen den Verschleiß erheblich fördern können. Gleichgültig bei welchem Waffensystem wird stets die erste Blende nach der Gewehrmündung am stärksten in Anspruch genommen, da sie die ungebremste Wucht der Verbrennungsgase aus dem Lauf abbekommt. In der Folge kann es zu einer Vergrößerung des Projektildurchlasses, dem sogenannten „Aufbrennen“ kommen, was keinen Totalschaden bedeutet, jedoch in fortschreitender Weise die Dämpfleistung vermindert. Hier können Ersatzteile bei modularen beziehungsweise zerlegbaren Modellen Abhilfe schaffen. Diese sind darüber hinaus auch einfacher zu reinigen, wobei beim anschließenden Zusammensetzen gut aufgepasst werden sollte, damit sich keine Blende in den Weg der Kugel verschiebt.
Neben dem Grundmaterial bietet der Markt dem interessierten Jäger von heute auch noch verschiedene Außenkonstruktionen zur Auswahl an. Neben den klassischen einfachen Schalldämpfern, die ganz unkompliziert ans Mündungsgewinde geschraubt werden, finden sich noch Teleskopdämpfer, welche den Lauf ein ganzes Stück nach hinten überwölben und so etwas an Gesamtlänge einsparen. Erkauft wird dieser Vorteil durch ein etwas höheres Gewicht und eine verringerte Dämpfleistung in dem Abschnitt, der den Lauf umschließt. Beide Konstruktionsarten haben gemein, dass die Länge des Dämpfers ungefähr das 20- bis 30-Fache des Patronenkalibers betragen sollte. Beim Durchmesser wird mit dem vier- bis fünffachen Kaliberwert gerechnet, wobei Einsparungen in einem Bereich Zugeständnisse im anderen erforderlich machen. Die beiden Öffnungen der Schalldämpferröhre sollten im Durchmesser ungefähr um ein Viertel größer sein als die verwendeten Projektile. Moderne Konstruktionen kommen allerdings häufig nur mit dem 1,12-Fachen aus. Wer sich überhaupt die Auf- und Abschrauberei sparen möchte, kann zu einer Büchse mit Integraldämpfer greifen, bei der die den Knall mindernde Vorrichtung fest mit der Waffe verbaut ist. Dies stellt jedoch auch den größten Nachteil solcher Konstruktionen dar, da sie sich eben nicht schnell einmal zwecks Wartung oder Austausch vom restlichen System trennen lassen.
Viel Lärm um (fast) nichts – rechtliche Aspekte
Nach all den technischen Betrachtungen ist es nun endlich an der Zeit, sich kurz mit der lustigen Welt der juristischen Belange auseinanderzusetzen. In der Bundesrepublik Deutschland sind Erwerb und Besitz von Schalldämpfern nicht grundsätzlich verboten. Allerdings sind Vorrichtungen zur Dämpfung des Schussknalls rechtlich den Waffen, an denen sie angebracht werden, gleichgestellt, weshalb der Gesetzgeber analog auch eine Aufbewahrung in Sicherheitsschränken mit der entsprechenden Klassifikation vorgibt. Wer einen Dämpfer für seine Büchse kaufen möchte, benötigt eine Erlaubnis, für deren Gewährung es mehrere Voraussetzungen braucht. Ist das Amt hinreichend von Eignung, Sachkunde, Zuverlässigkeit und dem diesbezüglichen Bedürfnis des Schalldämpferbesitzers in spe überzeugt, wird ein Voreintrag auf dessen Waffenbesitzkarte vorgenommen, welcher als Erwerbserlaubnis fungiert. Hat der glückliche Käufer den Amtsschimmel solcherart zufriedengestellt, muss er nur noch die Seriennummer seiner Neuerwerbung binnen 14 Tagen auf seiner Besitzkarte eintragen lassen, um sich nicht doch noch den Unmut dieses edlen Tieres zuzuziehen. Für die Nutzung an Luftdruckgewehren vorgesehene Schalldämpfer bedürfen nebenbei bemerkt keiner Erlaubnis, da für deren Erwerb ja auch nur das Erreichen der Volljährigkeit ausschlaggebend ist.
Bei Dämpfvorrichtungen, die zur Verwendung an Waffen mit Randzündermunition konzipiert sind, ist jedoch eine Sondererlaubnis erforderlich. Da sich mit derartigen Kleinkaliberwaffen ausgesprochen leise Schüsse abgeben lassen, eignen sie sich besonders für die Jagd in sensiblen Bereichen wie Friedhöfen. Aus dem genannten Grund betrachten sie die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden wohl auch mit solchem Argwohn. Ob ein Schalldämpfer letztlich bei der Jagd eingesetzt werden darf, ist noch von der Gesetzgebung des entsprechenden Bundeslandes abhängig. So darf mithilfe der „Flüstertüten“ nach Kenntnisstand der Redaktion beispielsweise in Sachsen-Anhalt oder Bremen nicht gejagt werden, während sie dem bayrischen oder brandenburgischen Weidmanne zur Benutzung freistehen. Nach einer langen Periode der Ablehnung gab es in den letzten Jahren in den meisten Bundesländern eine Hinwendung zur Liberalisierung des Umgangs mit Schalldämpfern, vor allem unter dem Aspekt des Gehörschutzes.
In Österreich zählen Schalldämpfer zwar sehr wohl grundsätzlich zu den verbotenen Waffen, doch räumte Vater Staat hier 2019 großzügig allen Weidleuten die Besitz- und Nutzungserlaubnis ein. Auch in der Alpenrepublik sind die schallschluckenden Metallröhren so sicher wie Schusswaffen aufzubewahren, werden dafür aber nicht extra registriert. Allerdings stellt eine gültige Jagdkarte die Besitzvoraussetzung dar, wobei laut Gesetz die regelmäßige Ausübung des Weidwerks sogar per Bescheid überprüft werden kann. Sollte jemand nicht mehr jagen können oder dürfen, hat er ein halbes Jahr Zeit, seinen Dämpfer an eine berechtigte Person abzugeben.
In der Schweiz sind Schalldämpfer ebenso als unzulässige Hilfsmittel der Jagd verboten, wobei die einzelnen Kantone individuelle Ausnahmegenehmigungen zu bestimmten Zwecken wie dem Schutz bedrohter Arten, der Vermeidung von Wildschäden oder für Fangschüsse erteilen können.
Einst verfemt und verachtet, nun weithin verbreitet und in jedem Fachgeschäft erhältlich, stellt der Schalldämpfer ein Paradebeispiel des Umgangs mit technischer Innovation auf dem breiten Feld weidmännischer Tätigkeiten dar. Einzelne Vorbehalte und Vorlieben tanzen den Schneeflocken vor dem Fenster gleich – vom eisigen Wind der Gesetzgebung getrieben – einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. Das alles nur, um schließlich zur Erde zu sinken und die ganze Winterlandschaft vom Himmel her in tiefe Ruhe zu betten.
Geschichtliches zum Schalldämpfer
Das erste Patent für eine Schalldämpfervorrichtung ist aus der Schweiz des Jahres 1894 bekannt. Der Patentinhaber C. A. Aeppli vermochte seine Konstruktion jedoch nicht zur Serienreife zu bringen, was auch für einige weitere Erfinderkollegen galt. Erst der US-Amerikaner Hiram Percy Maxim konnte mit seiner Firma ab 1910 Schalldämpfer zum Verkauf anbieten. Die Werbung richtete sich unter der Wortmarke „Dr. Shush“ an Hobbyschützen und Sportler, deren Nachbarn vor unerwünschtem Schusslärm geschützt werden sollten. Hiram Maxim, der Vater des Schalldämpferpioniers, hatte übrigens 1885 das erste wirklich vollautomatische Maschinengewehr erfunden, dessen Abkömmlinge im Ersten Weltkrieg massenhaft Einsatz fanden. Von der Bezeichnung des im Deutschen Kaiserreich hergestellten Modells leitet sich die noch heute gebräuchliche Redewendung „08/15“ ab.